Dorothee Krings ist Redakteurin bei der Düsseldorfer Tageszeitung „Rheinische Post“. Von meiner täglichen Lektüre der RP kenne ich sie als eine sehr reflektierte Kommentatorin aktueller politischer und gesellschaftlicher Ereignisse.
Nun hat sie mit „Tage aus Glas“ ihren ersten Roman über die weltweit bekannte Gerresheimer Glashütte in Düsseldorf geschrieben.
Als Gerresheimerin war es für mich ein „Muss“, den Roman zu lesen.
Es geht um die Ereignisse des großen Streiks der Glasbläser im Jahre 1901.
Zwar ist die Glashütte bekannt für ihre sozialen Leistungen. Es gibt eigens für die Arbeiter erbaute Wohnsiedlungen, die zum Teil bis heute erhalten sind. Auch das Gebäude der Badeanstalt für die Arbeiterschaft gibt es noch. Diese Wohltaten der Fabrikleitung täuschen jedoch nicht über die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse hinweg. Die Arbeit der Glasbläser, der sogenannten Püster, an den heißen Öfen ist gefährlich und gesundheitsschädlich, der Lohn ist äußerst schmal, so dass die Arbeiter in sehr ärmlichen Verhältnisse leben.
Der Roman beginnt mit einem Knaller, den Krings „Prolog“ nennt. Ein kleiner Junge verunglückt tödlich, als er auf einer Kirmes eine Stange hochklettert, um dort die begehrte Wurst zu erwischen. Die Szene fängt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Arbeiter ein. Alle leiden mit dem Vater, der sich schuldig fühlt.
Die Geschichte des Streiks und seines Ausgangs macht Dorothee Krings fest an der Geschichte ihrer Protagonisten Bille und Adam. Adam ist aus dem Thüringischen nach Düsseldorf gewandert, weil er sich in Gerresheim bessere Arbeitsbedingungen und besseren Lohn erhofft. Bille ist die Tochter eines Glasbläsers, die – wie fast alle jungen Mädchen – in der nahegelegenen Weberei arbeitet.
Adam und Bille begegnen sich beim Schwimmen in der Düssel. Adam träumt den Traum vieler junger Leute damals: Er will so viel Geld wie möglich sparen, um zusammen mit Bille nach Amerika auswandern zu können und sich dort ein besseres Leben aufzubauen. Deshalb beteiligt er sich auch nicht an dem großen, von den Sozialdemokraten initiierten Streik. Das bringt Bille in Konflikte, denn ihr Umfeld versteht Adams unsolidarisches Verhalten nicht. Außer Bille weiß allerdings niemand etwas von Adams Plänen.
Dorothee Krings gibt in ihrer Erzählung Einblicke in den Alltag der Arbeiterschaft, der aus Schufterei, aber auch kleinen Freuden besteht. Billes Vater ist zum Beispiel begeisterter Taubenzüchter.
Parallel zum Leben im „unteren Gerresheim“, also dem Gebiet um die Hütte, erzählt Krings vom Leben im gutbürgerlichen „oberen Gerresheim“. Die Arzttochter Leonie, im Wohlstand aufgewachsen, hat ein kritisches Verhältnis zu den Normen und Lebensformen ihrer Gesellschaftsschicht und träumt vom Ausbruch aus dieser künstlichen Welt. Es zieht sie zu einem alternativen Künstler, der die Welt der Arbeiter darstellt. Das kommt in ihren Kreisen jedoch nur sehr bedingt an.
Dorothee Krings bringt diese beiden Welten auf vielfältige Weise miteinander in Verbindung. Zu Leonies Kreisen gehört auch die Familie des Fabrikbesitzers. Wir werden Zeugen seines zynischen Umgangs mit den Streikenden. Er ist auf die bestehende Belegschaft gar nicht angewiesen, er kann sie ohne Probleme aussperren, weil scharenweise neue Arbeitskräfte aus den östlichen Landesteilen kommen, die die streikende Belegschaft ersetzen können, auch wenn sie nicht so qualifiziert arbeiten. Ohnehin sind neue Maschinen, die schon in Amerika verwendet werden, die Zukunft. Sie werden den Beruf des Püsters überflüssig machen.
Es ist das Verdienst von Dorothee Krings, mit ihrem Roman ein Stück Industriegeschichte zu erzählen, das mit dem Einzug der Moderne zu Ende gehen wird.
Die Geschichte von Bille und Adam einerseits und Leonie andererseits wird dabei leider zum Vehikel. Die Figuren sind eher Typen als Individuen, ihre Geschichten sind leicht vorhersagbar. Auch bemüht Krings etwas häufig den Zufall, um die beiden gesellschaftlichen Ebenen in Verbindung zu bringen. Zudem entgeht sie nicht ganz der Rührseligkeit, etwa wenn sie die Geschichte der alten Korbmacherin Leni erzählt. Deren Leben in großer Armut erscheint hier als Ort der Wärme und Menschlichkeit. Das klingt doch zu sehr nach Idylle.
Ihr Bemühen um literarisches Schreiben wirkt streckenweise etwas angestrengt mit Vergleichen oder Naturschreibungen, die wenig Funktion haben, etwa in einem Satz wie „Auf dem lichten Blau des Sommerhimmels waren Wolkenschlieren ausgeworfen wie Fischernetze.“
Insgesamt ist der Roman für Düsseldorfer Leserinnen und Leser durchaus informativ. Ich frage mich nur, warum Dorothee Krings nicht ein historisches Sachbuch geschrieben hat, in dem sie den Verlauf des Streiks, die Arbeitsbedingungen und die Rolle des Fabrikbesitzers in größerem historischen Zusammenhang hätte erörtern können. Ihr Können als Journalistin stellt sie mit ihren Beiträgen in der Rheinischen Post unter Beweis. Dazu muss sie keinen Roman schreiben.
Dorothee Krings: Tage aus Glas. Verlagsgruppe Harper Collins, 318 Seiten, 24 Euro.
Elke Trost

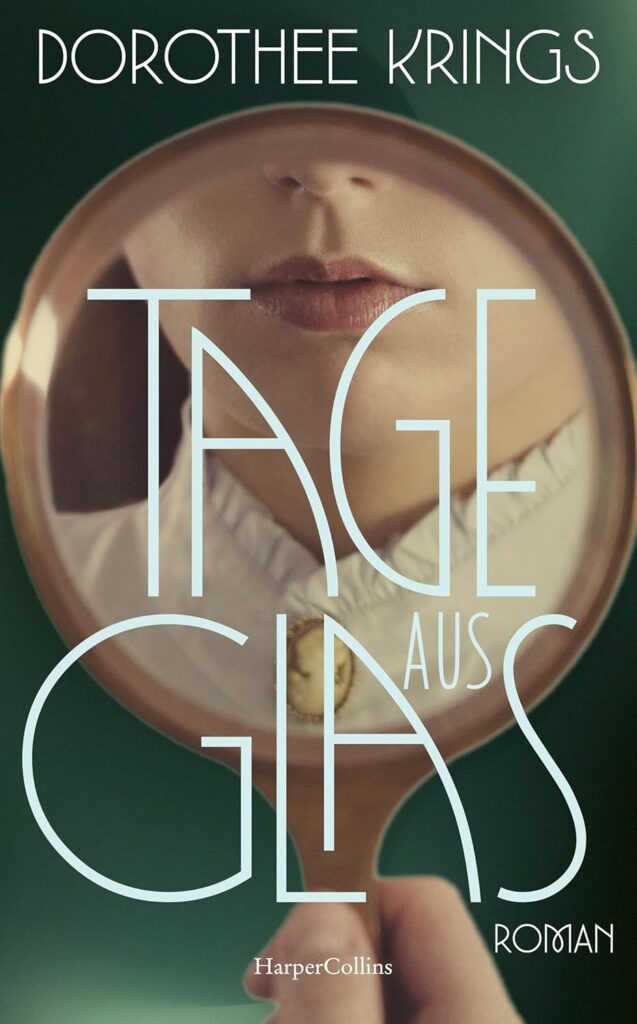
No comments yet.