Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Autor dieses Buches just in dem Jahr zur Welt kam, das zu einem Namensgeber für eine neue, aufklärerische Weltsicht wurde und damit den Kulturpessimismus zumindest konservativer Kreise beflügelte: 1968. In seinem Essay folgt er jedoch nicht den Spuren der „klassischen“ Kulturpessimisten, die einer „guten alten Kulturzeit“ nachtrauerten, sondern analysiert nüchtern und kritisch sowohl die rechten wie auch die linken – ja, die gibt es auch – Vertreter dieser Weltanschauung.
Gleich zu Beginn bescheinigt er allen Hochkulturen eine inhärente Fragilität wegen der zwangsläufig in diesen Umgebungen sich entwickelnden Autonomisierungstendenzen. Demnach führen Hochkulturen zur (Selbst-)Reflexion und damit zur geistigen und ethischen Aufladung des Individuums. Demnach hat die Moderne selbst die Autonomisierung des Individuums nach der Schleifung aller transzendenten Sicherheiten zum Selbstzweck gemacht. Grau zeigt das treffend am Beispiel der Kunst, die den bürgerlichen Widerspruch von Fortschritt und Romantik radikalisiert und die absoluten Normen der Vergangenheit aufgelöst habe. Massenkonsum und soziale Medien seien die logische Folge dieser Entwicklung.
Dem Kulturpessimismus des frühen 20. Jahrhunderts mit seiner fast schon naiven Nostalgie einer verlorenen „goldenen Zeit“ stellt Grau Oswald Spenglers eher deterministische Sicht sich zyklisch entwickelnder Kulturen entgegen und landet schließlich bei Adorno, dessen „Dialektik der Aufklärung“ er ebenfalls ein gute Portion elitären Nachtrauerns unterstellt. Dabei betont er, dass der Beginn des Kulturverlusts im Laufe des 20. Jahrhunderts immer weiter zurückgedreht wurde: von der anfänglichen Industrialisierung über die Aufklärung des 18. Jahrhunderts bis hin zu Aristoteles. Demnach war Kultur an die Mythen der frühen Menschheit gebunden, die noch unhinterfragte absolute Werte boten. Was Grau seltsamerweise nicht aufgreift, ist die Tatsache, dass diese – nicht zuletzt von Adorno so beschworenen – uralten Mythen Menschenopfer und eine generelle Missachtung des menschlichen Lebens beinhalteten. Man denke nur an die Erbauung der Pyramiden. Kurz gefasst: Kultur bedeutet Menschenopfer!
Dem Fortschritt widmet Grau ein eigenes Kapitel, wobei er die Entwicklung vom Fortschritt als Selbstzweck und dem Glauben an ihn zur noch rudimentären Hoffnung auf einen partikulären Fortschritt – etwa in der Medizin – nachzeichnet. Dagegen setzt er den kulturellen Niedergang, der sich in den Schriften von Le Bon – „Psychologie der Massen“ und Ortega Y Gasset – „Aufstand der Massen“ – niederschlägt. Dabei konstatiert Grau die intellektuelle Entwicklung von dem „Subjekt“ der Masse, die eine eigene Individualität entwickelt, zur Masse der Individuen, wobei er die Paradoxie herausarbeitet, dass sich die Masse gerade durch den – massenhaften – Wunsch des Individuums nach Besonderheit auszeichnet.
Abschließend arbeitet Grau in einer luziden Argumentation die sich geradezu logisch bis hin zur je individuellen Weltsicht einschließlich Verleugnung der sogenannten „Realität“ entwickelnde Individualität heraus. Demnach gibt es im Grunde genommen keine objektive Realität, sondern diese ist nur die Ideologie einer eingeschränkten Rationalität, die wiederum wahlweise auf (macht)politischen oder ökonomischen Interessen beruht. Am Ende weht dann die Fahne „Kultur ODER Aufklärung“, und der Ideologe ist im Zweifelsfall immer der andere.
Dieser kleine Essayband beginnt als spöttisch lächelnde Abhandlung einer großbürgerlichen Kulturnostalgie und endet als rasante intellektuelle Parforcetour durch den philosophischen Zeitgeist der letzten fünfzig Jahre. Fast könnte man die kulturkritischen Ausführungen vieler hier zitierter Autoren mit dem kurzen Satz zusammenfassen: „Die Kultur endet mit mir!“
Das Buch ist im Verlag zu Klampen erschienen, umfasst 157 Seiten und kostet 20 Euro.
Frank Raudszus

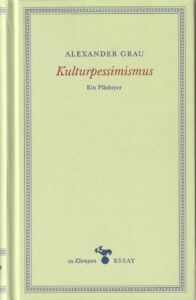
No comments yet.