Nicht zufällig könnte der letzte Satz dieses Buches für dessen Motto herhalten: „… daher stammt unsere Vorliebe für eine borderless world, eine Wiege für alte, verwöhnte Kinder.“. Er stammt von dem französischen Philosophen Regis Debray und ist mit seinem Entstehungsjahr 2016 durchaus nicht veraltet.
Bernd Ahrbeck unterzieht als Erziehungswissenschaftler, Psychologe und Psychoanalytiker den – von den USA ausgehenden – kulturellen Diskurs der letzten zwanzig Jahre einer kritischen Analyse. Verglichen mit Autoren wie Bolz, Balzer oder Fourest sagt er im Prinzip nichts Neues, bringt jedoch die von den anderen Autoren geäußerte Kritik an den Auswüchsen neuer Strömungen mit wissenschaftlicher Nüchternheit – doch mit Engagement! – auf den Punkt.
In sieben Kapiteln behandelt Ahrbeck die Themen „Gerechtigkeit“, „Inklusion“, Sexualpädagogik“, „Transgender“, „Identitätspolitik“, „Vergangenheit“ und „Grenzen“.
Die Gerechtigkeit wandelt sich aus der Sicht der selbsternannten Avantgarde von einem allgemeinen, wertegeleiteten Begriff in einen individuellen, emotionalen. Demnach ist das Gefühl der persönlichen Betroffenheit maßgebend für den Grad existierender Gerechtigkeit. Unabhängig von eventueller individueller Klageberechtigung eröffnet eine solche Sicht natürlich Tür und Tor für beliebige Forderungen an eine per se ungerechte Gesellschaft, die diese Forderungen entweder mit „sozialer Kälte“ ablehnen oder in voreilendem Gehorsam akzeptieren kann. Lakonisch verweist Ahrbeck auf die Tatsache, dass unbegrenzte individuelle Forderungen implizit an anderer Stelle zu Ungerechtigkeit führen. Für die einschlägigen Kreise ist jedoch die organisierte Gesellschaft per se repressiv, und ihr Verschwinden führt zu allgemeiner Gerechtigkeit.
Diese Argumentation setzt sich fort in der „Inklusion“, die den Einschluss aller Schüler in eine einzige , übergreifende Schulform fordert, da spezielle Förderung Segregation und Diskriminierung bedeute. Dabei wird bei Menschen, auch den sogenannten „behinderten“, eine gleiches kreatives Potential unterstellt, das sich nur bei totaler Gleichheit der äußeren Bedingungen frei entfalten kann. Dazu gehört dann natürlich zwangsläufig die Abschaffung von Noten und Wettbewerb jeglicher Art. Ahrbeck attestiert dieser Richtung einen weitgehenden Realitätsverlust, da alle bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse fatale Folgen für die Betroffenen zeigten, was die Inklusions-Ideologen jedoch ignorierten.
Die einschlägige Sexualpädagogik fordert laut Ahrbeck nicht nur die frühe Einführung – spätestens Grundschule – der Kinder in alle sexuellen Varianten, sondern geht in Extremen sogar soweit, die Kinder selbst an die praktische Sexualität heranzuführen, wobei in herausgehobenen Fällen sogar die absichtliche Zuführung von Kindern zu Pädophilen zwecks praktischer Einführung in eine erfüllende Sexualität erfolgt ist. Auch hier die Ablehnung jeglicher herkömmlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Transgender mit der massiven Bekämpfung binärer, nur sozial konstruierter, Geschlechterrollen folgt dann dem selben Muster. Ahrbeck kritisiert vehement – aber sachlich! – die Freigabe der Geschlechtsumwandlung ab dem 14. Lebensjahr, da hier noch keine Lebenserfahrung vorliege und geschlechtliches Unbehagen meist der – temporären – Pubertät geschuldet sei. Umwandlungen seien aber weitgehend irreversibel und könnten damit zu dauerndem Leid führen. Für die Avantgarde der neuen Sexualpädagogik sei aber gerade die Zuordnung zu einer von zwei Kategorien repressiv, und bei völliger Freiheit des Geschlechts winke den Menschen eine glückliche Freiheit.
Dem Motto folgt auch die neue Identitätspolitik, wobei sich hier eine grundlegende Forderung gerade der „Avantgarde“ selbst widerspricht. Stand anfangs die Forderung nach Nichtbeachtung aller biologischen – Hautfarbe – und kulturellen – Kopftuch – Merkmale zwecks allgemeiner Gleichheit (und Gerechtigkeit) im Vordergrund, wird jetzt der „Besitz“ dieser Merkmale als Eigentum gepriesen, dass kein Außenstehender missbrauchen dürfe. „Kulturelle Aneignung“ ist der entsprechende Kampfbegriff, und ein bedenkenlos vorgetragener Kulturrelativismus entschuldigt sogar Genitalverstümmlung bei Frauen als alte Tradition, die erst die weiße Repression zur schmerzhaften Verstümmelung umdefiniert habe.
Die Vergangenheit spielt für den neuen Diskurs eine ambivalente Rolle. Alte Sünden der (weißen) Kolonialmächte stehen ewig wie Statuen im Raum, doch aufklärerische Entwicklungen – Kant, Marx, Demokratie und Rechtsstaat werden rundweg ignoriert oder als repressives Unterfangen skandalisiert. Damit lässt sich dann auch jeder Widerspruch innerhalb des identitären Diskurses ausblenden und entsprechende Kritik abschmettern.
In „Grenzen“ plädiert Ahrbeck vehement aber nie polemisch für eine aktive Erziehung der Kinder, die von der anderen Seite grundsätzlich als repressiv und einschränkend verurteilt wird. Für ihn gibt es einen verpflichtenden Generationenvertrag, der die Erfahrung der älteren – „Eltern“ – an die nächste Generation vermittelt und dabei auch eindeutige Grenzen aufzeigt. Die Binsenweisheit, dass jede neue, individuelle Freiheit an anderer Stelle zu Unfreiheit führt, lässt sich für Ahrbeck nicht durch ein utopisches Wunschdenken außer Kraft setzen. Die „borderless world“ führt schließlich zur vollständigen Desorientierung und ethischen Vereinsamung der nachfolgenden Generation.
Der hier erfolgte Abriss der Argumentation kann nur eine grobe Übersicht wiedergeben. Den Lesern dieser Rezension sei daher die Lektüre des Buches ans Herz gelegt.
Es ist im Verlag „zu Klampen“ erschienen, umfasst 155 Seiten und kostet 18 Euro.
Frank Raudszus

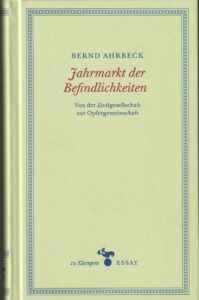
No comments yet.