Mathias Brodkorb, Jahrgang 1977, hat Philosophie studiert und arbeitet als freier Journalist. Als SPD-Mitglied war er lange als mecklenburgischer Abgeordneter und Minister im politischen Geschäft tätig.
Diese (gesellschafts)politische Einordnung scheint dem Rezensenten notwendig, um eine falsche, d.h. „rechte“ Zuordnung seitens der Leser zu vermeiden, denn Brodkorb bezieht deutlich Stellung gegen eine vor allem in linksliberalen Kreisen verbreitete Weltsicht.
Es geht in dem vorliegenden Buch mit dem Untertitel „Auf den Spuren eines modischen Narrativs“ um die Restitution kultureller Artefakte aus dem afrikanischen Raum, die vor allem unter dem Begriff der „Benin-Bronzen“ seit einigen Jahren kräftige Diskurswellen ausgelöst hat. Dabei haben sich vor allem „postkoloniale“ Kritiker für eine Rückgabe dieser Kunstwerke stark gemacht, da westliche Kolonisatoren sie angeblich geraubt oder zumindest unrechtmäßig an sich gebracht hätten. Die Medien haben diese Sicht mit nur geringen Bedenken weitgehend unterstützt, wenn auch die ein oder andere Zeitung Gegenargumente vorbrachte. Dieter Thomä hat diese „Post“-Variante eingehend untersucht und die dahinter liegenden Beweggründe ausgeleuchtet.
Brodkorb hat den Post-Kolonialismus seinerseits anhand der Aktivitäten ausgewählter europäischer Museen untersucht und sich dabei aus naheliegenden Gründen auf Museen mit „völkerkundlichem“ Schwerpunkt konzentriert. Die vom Rezensenten gesetzten Anführungsstriche sollen dabei verdeutlichen, dass selbst dieser scheinbar sachliche Begriff in gewissen Kreisen als „völkisch“ und damit fragwürdig angesehen wird.
Brodkorb beginnt mit einer Rückschau auf die kolonialen Aktivitäten des Kaiserreiches, das gegenüber anderen europäischen Ländern auf eine gerade einmal 35-jährige Kolonialgeschichte kam, die 1914 abrupt endete. Anhand der Aktivitäten im heutigen Namibia und in Tansania arbeitet er klar heraus, dass zwar die Kolonisation fremder Länder an sich nicht zu entschuldigen ist, dass aber gerade die Sklaverei, einer der größten Vorwürfe des Post-Kolonialismus an den Westen, nicht nur von Arabern und innerafrikanischen Ländern bereits vor der Ankunft des Westens gewinnbringend betrieben wurde, sondern auch auf Betreiben des Westens – England und Deutschland – und gegen den Widerstand der Einheimischen beendet wurde. Damit ist ein Kernelement des Post-Kolonialismus bereits in Frage gestellt, da die Sklaverei offensichtlich ein allgemeines und kein rein westliches Problem war. Den Sklavenhandel in die Südstaaten der USA entschuldigt er damit in keiner Weise.
Auch die „Raubkunst“ in den Museen des Westens ist dort gemäß Brodkorbs Recherchen nicht (nur) durch koloniale Gewalt in europäische Hände gelangt, sondern gemäß vorliegender Korrespondenz in vielen Fällen durch Kauf seitens reisender Kaufleute oder als Geschenk lokaler Herrscher an die Regierungen kolonialer Länder, etwa an den deutschen Kaiser. Dabei haben seine weiteren Recherchen ergeben, dass diese Tatsachen von postkolonialen Ideologen entweder beschwiegen oder als durch asymmetrische Machtverhältnisse bedingt denunziert werden. Durchgehend sieht die postkoloniale Theorie den Westen als alleinigen Täter und die kolonisierten Länder als alleinige Opfer.
Nach der Untersuchung deutscher kolonialer Aktivitäten beginnt Brodkorb einen Gang durch große europäische (Völkerkunde-)Museen und analysiert dabei die Präsentation der dort gelagerten Artefakte sowie die jeweilige Haltung zur Restitutionsfrage. Nacheinander rücken die entsprechenden Ausstellungen im Grassi-Museum Leipzig, im Berliner Humboldt-Forum, im Wiener Weltmuseum, im Hamburger MARKK (Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste) sowie auf der venezianischen Biennale 2024 in den Mittelpunkt der Betrachtungen.
Ohne hier auf die einzelnen Ausstellungen einzugehen, lässt sich eindeutig feststellen, dass alle heutigen Museumsleitungen die Haltung der „relativen Wahrheiten“ einnehmen, derzufolge es keine universellen Fakten und Werte gibt, sondern nur die Wahrheiten vermeintlich oder tatsächlich betroffener Gesellschaften. Dabei geht es eindeutig um eine klare Aufteilung zwischen weißen Tätern und schwarzen Opfern. Wo die Fakten sich sperren, erfolgt je nach Beweislast das Leugnen, das Beschweigen oder das Bagatellisieren. So kann innerafrikanische Sklaverei als vernachlässigbar betrachtet werden, weil es kaum historische belegte Zahlen gibt. Schriftliche Schutzverträge zwischen Kolonialmächten und lokalen Fürsten, die letztere gebrochen und sogar mit tödlicher Gewalt außer Kraft gesetzt hatten, werden als erzwungen entwertet, obwohl alle schriftlichen Aufzeichnungen auf Freiwilligkeit schließen lassen. Nachweisbare Käufe oder Geschenke seitens lokaler Größen werden dann nachträglich als Erpressung dargestellt. Einige Ideologen – so muss man sie wohl bezeichnen – gehen dabei sogar so weit, dass sie das Wissen und die Erfahrung der Weißen gegen die Naivität der Schwarzen ausspielen und damit ungewollt in einen rassistischen Paternalismus verfallen.
Im Falle des Wiener Museums ergibt sich daraus eine ungewollte bittere Ironie, wenn die „koloniefreie“ k.u.k.-Monarchie wegen ihrer Zugehörigkeit zum „weißen Westen“ als zumindest gedankliche Kolonialmacht entlarvt wird. Dabei hätte man in Wien wunderbar die quasi-koloniale Vergangenheit des k.u.k.-Vielvölkerstaats nach allen Regeln der Kunst anklagen können, hätte damit aber nicht die erforderliche Schwarz-Weiß-Konfrontation bedienen können. So musste man sich an der Weltreise des früh verstorbenen Thronfolgers Franz-Ferdinand abarbeiten, die ja auch durch koloniale Gebiete führte.
Brodkorb trägt diese faktenaversen und sich oftmals selbst widersprechenden Theorien zum Kolonialismus mit – streckenweise mühsam eingehaltener – Sachlichkeit vor. Teilweise werden diese unhaltbaren Theorien mit einer solchen moralistischen Arroganz vorgetragen, dass sich jeder vernünftige Mensch an den Kopf schlagen müsste; doch Brodkorb weiß, dass eine solche emotionale Reaktion Wasser auf die Mühlen seiner logikunwilligen Gesprächspartner wäre. Und die sachliche Präsentation der Fakten und (Nicht-)Argumente spricht sowieso für sich. Dabei haben einige Museumsdirektoren – und nicht die unwichtigsten! – Gespräche verweigert und auf detaillierte Fragen nicht geantwortet. Auch dieses Verhalten sagt alles.
Brodkorb resümiert denn auch, dass die Selbstkasteiung der weiß-westlichen Museumsleitungen nicht anders zu verstehen ist denn als moralische Selbstüberhebung. Wer in einer bestimmten Diskurslandschaft sachlich keine oder nur unzureichende Distinktion erreichen kann, sucht sie im Moralismus und überhöht bewusst bestimmte Positionen, um die Umwelt moralisch zu beschämen. Leider gibt es genügend politische und mediale Institutionen, die mehr Angst vor einem moralischen Shitstorm als vor dem Vorwurf der Faktennegierung haben. Offensichtlich haben (pseudo-)moralische Kampagnen in der Welt der (a)sozialen Medien mehr Gewicht als Fakten und Logik.
Diesen circulus vitiosus kann man nur durch die Lektüre von Büchern wie diesem und durch deutliche Meinungsäußerung stoppen. Andererseits setzt Brodkorb auch eine gewisse Hoffnung auf die Macht der Fakten, wenn er berichtet, dass die Besucherzahlen bei den besuchten Museen in den letzten Jahren in erschreckendem Maße zurückgegangen sind. Trotz oder vielleicht gerade wegen der faktenresistenten postkolonialen Behandlung der Restitutionsfrage?
Das Buch ist im Verlag zu Klampen erschienen, umfasst einschließlich umfangreicher Quellennachweise 268 Seiten und kostet 28 Euro.
Frank Raudszus

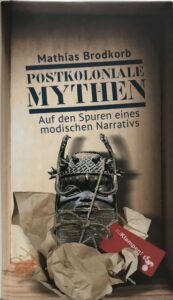
No comments yet.