Der 2024 in den USA erschienene neue Roman „Creation Lake“ der amerikanischen Schriftstellerin Rachel Kushner ist nun auch auf Deutsch beim Rowohlt Verlag unter dem Titel „See der Schöpfung“ erschienen.
Rachel Kushner legt mit diesem Roman eine radikale Zivilisationskritik vor, die sie an der Lebensform der alternativen Landkommune „Le Moulin“ in Südfrankreich festmacht.
Diese Kommune wird ideologisch begleitet von dem Aussteiger Bruno Lecombe, der zeitweilig in einer Höhle lebt und dabei ist, den Zusammenhang des Menschen mit der Natur und dem Kosmos wieder zu erkennen und das an die Gruppe weiterzugeben. Er wiederum ist beeinflusst von dem französischen Kapitalismuskritiker Guy Debord (1931 – 1994). Dessen politischer Aufruf an die Arbeiterschaft war ein radikales „Ne travaillez jamais“.
Bruno postet über E-Mail grundlegende anthropologische Überlegungen, die sich auf die Lebensweise der Neandertaler beziehen. Sie seien eine Hoffnung für die weitere Entwicklung der Menschheit gewesen, friedlich und kreativ. Aber mit dem homo sapiens seien die Menschen falsch abgebogen, so dass mit ihnen Machtstreben, Kriege und Zerstörung in die Welt gekommen seien. Lecombe versucht, die Kommune auf den Weg zu bringen, sich selbst und ihren Bezug zu Natur und Kosmos neu zu definieren. Erst in der völligen Dunkelheit der Höhle habe er das richtige Sehen erfahren, die inneren Bilder seien wahrhaftiger und leuchtender als die Bilder, die man in der Helligkeit sehe. Das kennen wir eigentlich schon seit Teiresias, dem blinden griechischen Seher.
In seiner Weltabgewandtheit bemerkt Lacombe überhaupt nicht, dass die Moulinarden sich unter ihrem Anführer Pascal zunehmend von ihm abwenden. Offenbar liest außer Pascal ohnehin niemand seine Mails.
Das alles erfahren wir von der Ich-Erzählerin, einer amerikanischen Agentin, die unter dem Namen Sadie Smith für einen ihr nicht bekannten privaten Auftraggeber die Moulinarden unterwandern soll. Die Moulinarden kämpfen gegen ein geplantes Großbassin, das die Wasserversorgung für industrielle Großunternehmen in der Gegend sichern soll. Die Moulinarden und auch die Bauern der Umgebung sehen darin eine Umweltkatastrophe, die die Bevölkerung und insbesondere die Bauern unter Umständen ganz von der Wasserzufuhr abtrennen könnte. Aus Anlass einer großen Landwirtschaftsmesse, zu der auch ein Staatssekretär kommen wird, soll es eine große Demonstration mit spektakulären Aktionen geben.
Sadies Aufgabe ist es, die Gruppe möglichst zu illegalen Aktionen zu verleiten, sodass die Gruppe rechtlich belangt werden und aufgelöst werden könnte. Sadie ist mit ihren 34 Jahren bereits eine hart gesottene Agentin, die ihren Einsatz professionell plant. Skrupel kennt sie nicht. Aus ihrer Zeit als Agentin für den US-Geheimdienst weiß sie, dass es nicht darauf ankommt, tatsächliche kriminelle oder staatsfeindliche Aktivitäten aufzudecken. Vielmehr geht es darum, unliebsame Gruppen, die regierungskritisch sind oder alternative Lebensformen beschwören, auszuschalten. Wo es nichts Kriminelles oder Rechtswidriges gibt, muss es eben erfunden oder befördert werden.
In diesem Fall hat sie den Zugang zu Brunos Mails, ist also bestens über die ideologische „Betreuung“ der Gruppe durch Lecombe informiert. In der Gruppe selbst dient sie sich als Übersetzerin des Buches an, das der Anführer Pascal geschrieben hat.
Die Handlung des Romans bewegt sich in kleinen Schritten, immer entlang an dem strategischen Vorgehen von Sadie. Dennoch liest sich der Roman durchaus spannend, denn es bleibt bis kurz vor Ende des Romans unklar, ob Sadie wirklich ganz in ihrer Agentenrolle aufgeht oder ob sie selbst von Brunos theoretischen Ausführungen beeinflusst wird. Nach außen bleibt sie diejenige, die im Sinne ihres Auftrags die Menschen benutzt, auch vor geheuchelten Liebesbeziehungen nicht zurückschreckt. Doch ganz ohne moralisches Gewissen ist sie nicht, denn ihr geht immer wieder die Geschichte zweier junger, alternativer Menschen durch den Kopf, die sie zu Straftaten angestiftet hat. Beide werden in einem Strafverfahren verurteilt.
Von Zeit zu Zeit flackert in ihr ein Bewusstsein davon auf, dass sie sich ständig in Scheinexistenzen bewegt, die stets nur temporär gültig sind. Sie ist auf dem besten Wege, ihre eigene Identität zu verlieren. Solche Gedanken lässt sie allerdings nur kurz zu. Dagegen helfen Stimmungsaufheller und Schlafmittel, wenn die Gedanken sich nachts nicht verscheuchen lassen.
Der Roman fordert Leserinnen und Leser heraus, sich mit den Thesen des Vordenkers Bruno auseinanderzusetzen. Sind dieses nur Fantastereien eines ausgestiegenen Spinners? Oder liegt die Rettung des homo sapiens in der Tat in einer grundlegenden Umkehr von technischem Forstschritt und zivilisatorischen Auswüchsen, wie er sie etwa in der totalen Orientierung mit digitalen Medien sieht. Warum brauchen wir alle diese Geräte und Maschinen, fragt er, wenn doch schon vor Urzeiten Menschen in der Lage waren zu navigieren, indem sie den Himmel studierten?
Die Autorin sieht gleichzeitig die Gefahren solcher Abwendung, wie sie sich in der Kommune zeigen. Hier werden neue Abhängigkeiten geschaffen, die Kommunarden folgen kritiklos ihrem Anführer, dessen Motive jedoch unklar bleiben. Wer sich zu kritisch einbringt, wird von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen. Der von Pascal und seinen geistigen Mitstreitern in der Kommune gepredigte Gemeinschaftsgeist, dem die eigene Individualität geopfert werden müsse, wird von der Kritikerin Nadja entlarvt. Solche Positionen könne sich nur jemand leisten, der wie Pascal aus einer begüterten Pariser Familie stammt, die im Notfall die besten Anwälte einschaltet. Das können sich die einfachen Mitglieder dann leider nicht leisten. Sie sind es, die die Konsequenzen einer Auflehnung gegen die staatliche Gewalt tragen müssen.
Auf allen gesellschaftlichen Ebenen macht Kushner Scheinwelten aus. Die Regionalpolitiker geben sich dazu her, das Projekt des Groß-Wasserbassins als gesellschaftlichen Fortschritt für alle zu loben, obwohl es in Wahrheit um die Profitinteressen von Unternehmen und Großkapital geht. Geheimdienste und Geheimagenten lassen sich für diese Interessen benutzen und führen die Aufträge mit zynischem Pragmatismus aus. Um Wahrheitsfindung geht es dabei offenbar nie, eher um Verschleierung der Wahrheit.
Insgesamt ist „See der Schöpfung“ ein hochinteressanter Roman, der mehr von der Entfaltung anthropologischer, soziologischer und ökologischer Thesen lebt als von der Handlung, uns aber dennoch – oder gerade deswegen – in den Bann zieht. Ich habe den Roman mit großem Interesse gelesen, die fehlende Handlungsdynamik hat dem keinen Abbruch getan.
„See der Schöpfung“ ist ein wichtiger und unbedingt lesenswerter Roman, gerade in einer Zeit, in der viele die Orientierung verlieren angesichts zu vieler widerstreitender Interessen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen.
Rachel Kushner, „See der Schöpfung“, Roman, aus dem Englischen übersetzt von Bettina Abarbanell; Rowohlt Verlag 2025, 475 Seiten, 26 Euro.
Elke Trost

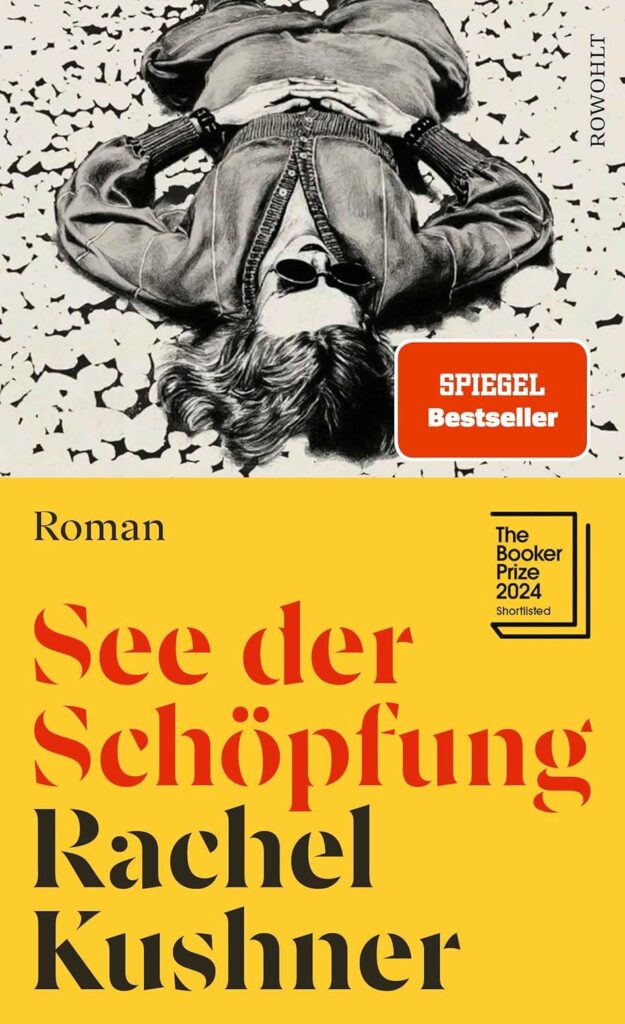
No comments yet.