Welch ein Buch! Der Verlag Kiepenheuer & Witsch hat den fast vergessenen Roman „Getäuscht“ des russischen Schriftstellers Juri Felsen neu aufgelegt. Dafür gebührt dem Verlag großer Dank, denn er hat ein literarisches Kleinod aus der Versenkung ans Licht geholt.
Juri Felsen (1894 – 1943) wurde als Nikolai Freudenstein in St. Petersburg als Sohn einer jüdischen Familie geboren. 1921 floh er aus Russland zunächst nach Berlin, um sich dann 1923 in Paris niederzulassen. Dort nahm er den Namen Juri Felsen an. In Paris schloss er sich der literarischen und künstlerischen Bohème an. Literarisch wurde er u.a. von Marcel Proust, André Gide, James Joyce und Virginia Woolf beeinflusst. Juri Felsen galt als einer der großen Schriftsteller seiner Zeit. Den Roman „Getäuscht“ schrieb er im Jahr 1930.
Die Flucht vor den Nazis misslang. Juri Felsen wurde verhaftet, deportiert und schließlich 1943 in Auschwitz ermordet.
„Getäuscht“ ist das Psychogramm des Erzählers, der sich in eine unerwiderte Liebesgeschichte verstrickt. Alle Höhen und Tiefen von höchstem Glücksgefühl bis zu größter Verzweiflung hält der Ich-Erzähler in seinem Tagebuch fest, an dem er uns als Leserinnen und Leser teilhaben lässt. Allerdings lässt er uns in seinen Reflexionen wissen, dass die Aufzeichnung der Ereignisse immer zugleich eine Rekonstruktion ist, die das wirkliche Geschehen bearbeitet, es beschönigt oder dramatisiert. Diesem Erzähler ist also mit Vorsicht zu begegnen, denn wir erfahren alles aus seiner Sicht, in der von ihm bereinigten Fassung, dazu noch als Tagebuchnotizen, die eigentlich nur dem Schreiber selbst dienen sollten zur Klärung seiner existenziellen Seelenzustände. Hier verbirgt sich ein Erzähler hinter dem Tagebuchschreiber, der eigentlich ein Schriftsteller sein will.
Die Handlung ist schnell erzählt. Der Erzähler lebt als Exilrusse in den 1920er Jahren in Paris, bewegt sich im Wesentlichen in der Szene der Exilrussen, wie der Autor selbst. Er selbst ist offenbar ein durchaus erfolgreicher Geschäftsmann, seinen Namen verrät er uns nicht (muss er auch nicht, weil er sich als Tagebuchschreiber definiert). Was genau er betreibt, bleibt unklar. Bei allem beruflichen Erfolg bleibt er ein einsamer Mensch, der seine ganze Hoffnung auf die Begegnung mit Ljolja, ebenfalls Exilrussin, setzt. Freunde haben diese Begegnung vermittelt, offenbar in durchaus kupplerischer Absicht.
Der Erzähler stürzt sich in diese neue Beziehung, überzeugt, dass Ljolja die gleichen Gefühle für ihn hegt. Die Eintragungen in seinem Tagebuch ziehen sich hin von Dezember bis Oktober des Folgejahres. Ljolja ist eine Frau mit Vergangenheit, es gibt noch einen Ehemann, der sie jedoch offensichtlich verlassen hat. Der Erzähler fühlt sich als ihr Retter, schmiedet langfristige Pläne in verblendeter Selbstüberschätzung. Als Leserin war ich geneigt, mich für ihn fremdzuschämen, wenn er auch dann nicht von ihrer Seite weicht, als sie sich längst einem anderen zugewandt hat. In geradezu masochistischer Eifersucht erträgt er allen Spott und alle Zurückweisung, denn er ist sich sicher, dass sie ihren Fehler erkennen wird und zu ihm zurückkehren wird.
In seinem Tagebuch reflektiert er über eben diese Gefühle und über sein entwürdigendes Verhalten. Im Nachhinein erkennt er, wenn man seinen Aufzeichnungen Glauben schenken darf, sein eigenes Getrieben-Sein. Aber rationale Erkenntnis bedeutet nicht, dass die Gefühle in den Griff zu bekommen sind, Kopf und Herz arbeiten gegeneinander.
Als Leserinnen und Leser gehen wir mit ihm durch diese Gefühlshölle, wir möchten ihm zurufen: Lass sie laufen, sie spielt mit dir, sie ist diese Wechselbäder der Gefühle nicht wert. Aber er ist für die eigenen Einwände schon nicht erreichbar, wie denn für Rufe von außen.
Juri Felsen beschert uns mit diesem Roman Einblicke in das gesellschaftliche Leben der Exilrussen in Paris, es scheint, dass sie von ihrer Sehnsucht nach der verlorenen Heimat nicht loskommen, einer alten Welt nachtrauern, die es nicht mehr gibt. Dieser Kreis kann sich nicht auf das weltoffene Paris einlassen, schon deshalb kommt der Erzähler von Ljolja nicht los.
Auch mit zwei parallel laufenden Affären zwischendurch bleibt er diesem Kreis verhaftet. So konzentriert er erneut alles auf Ljolja, sobald er eine Hoffnung auf einen Neuanfang sieht, die sich jedoch wieder als Illusion erweist. Trotz aller Fehlschläge – auch in Beziehungen vor Ljolja – hat er sich einen ununterdrückbaren Glauben an die Liebe erhalten.
Sein Frauenbild ist zwiespältig. Die meisten Frauen können es nach seinem Selbstbild mit ihm nicht aufnehmen, sie sind dumm oder geschwätzig, naiv oder schlicht langweilig. Dennoch schwebt ihm das Ideal einer Partnerschaft auf Augenhöhe vor, in der sich Mann und Frau auf hohem Niveau begegnen. In ihrem Nachwort interpretiert Dana Vowinckel ihn – aus heutiger Sicht – als ein typisches Beispiel für toxische Männlichkeit. Ich kann dem nicht zustimmen. Dazu ist er viel zu sehr von Selbstzweifeln getrieben. Eher ist er der exzentrische Neurotiker, der es nicht lassen kann, sich selbst zu beobachten und zu analysieren, seine Verzweiflung auszuleben und sie gleichzeitig zu erklären. All das hilft ihm jedoch nicht, zu einer gelassenen Sicht auf die Frau zu kommen, der er sich verschrieben hat.
Von seinen Nöten, seinen Gedanken über Liebe und Eifersucht, über Freundschaft und Verrat, über die Welt der Geschäfte einerseits und die Welt der Gefühle andererseits erfahren wir in einem fast gehetzten Ton, denn die Aufzeichnungen erfolgen in der Nacht, oft bis in den Morgen hinein. Obwohl in diesem Roman eigentlich nicht viel passiert, konnte ich das Buch kaum aus der Hand legen, so zog es mich in den Bann des Schreibenden. Schließlich wird aus dieser Eifersuchtsgeschichte eine Erzählung über die Entwicklung des Schreibers zum Schriftsteller, es ist ein Roman über die Entstehung von Literatur aus dem Leiden. Gleichzeitig misstraut dieser Schreibende den Wörtern, denn sie könnten nie eine „exakte Übereinstimmung“ mit dem Erlebten schaffen. Damit ist das Thema „Literatur als Lüge“ angeschnitten, da „die künstliche Rekonstruktion von Vergangenem … oftmals konturierter, stärker“ sei, als das, „was wir rekonstruieren“.
Der Drang zum „Schreiben“ wird für ihn „zu einer Art Leidenschaft, verbunden mit Ungeduld und Hass gegenüber Menschen oder Dingen“, die ihn daran hindern. Angesichts des Bedürfnisses zu schreiben erscheinen ihm alle Alltagsverpflichtungen als albern, denn sie nehmen ihm die kostbaren „Tages- und Abendstunden“.
Dieser Roman hat offenbar einen autobiographischen Hintergrund, ohne aber der neuen Mode der Autofiktion zu entsprechen. Mit dem Schreibenden entsteht eine literarische Figur, die sich von der realen Existenz Juri Felsens löst. Wohl aber täuscht der Schreibende Authentizität vor, etwa indem er seinen Aufzeichnungen jeweils genaue Datierungen voranstellt.
Die Faszination dieses Romans liegt in der fast selbstzerstörerischen Sezierung der eigenen Seelenzustände, aus denen der Schreibende allgemeine Überlegungen ableitet.
Lesenswert ist das Vorwort der Übersetzerin Rosemarie Tietze, die auf besondere Feinheiten der Übertragung aus dem Russischen hinweist. So sei die wörtliche Übersetzung des russischen Titels eigentlich „Täuschung“. Sie habe sich jedoch für den Titel „Getäuscht“ entschieden, weil so die in dem russischen Titel „obman“ enthaltene Konnotation besser getroffen sei. Worauf sich „Getäuscht“ beziehen kann, soll hier nicht weiter erörtert werden. Das herauszufinden ist Aufgabe der hoffentlich ebenfalls beeindruckten Leserinnen und Leser.
Auch Dana Vowinckels Nachwort gibt viele Einsichten in die Hintergründe des Romans sowie Ansätze der Interpretation, die ich zwar nicht immer teile, die aber durchaus als Anregung sinnvoll und nützlich sind.
Insgesamt ist diese Wiederentdeckung eine Bereicherung für das Verständnis der Exilliteratur im Paris der 1920er und 1930er Jahre.
Juri Felsen, Getäuscht, aus dem Russischen übersetzt und mit einem Vorwort von Rosemarie Tietze, mit einem Nachwort von Dana Vowinckel. Verlag Kiepenheuer & Witsch 2025, 272 Seiten, 26 Euro.
Elke Trost

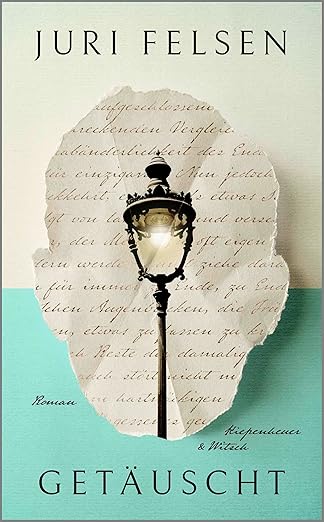
No comments yet.