Der deutsch klingende Name dieses amerikanischen Philosophen hat durchaus einen „moralischen“ Hintergrund, mussten doch Nagels jüdische Eltern aus Deutschland nach Belgrad fliehen, wo 1937 ihr Sohn Thomas zur Welt kam. Der weitere Fluchtweg führte sie dann in die USA.
In seinen Betrachtungen über das Wesen der Moral bezieht sich Nagel jedoch mit keinem Wort auf seinen biographischen Hintergrund. Überhaupt spielen die Religionen, vor allem die jüdische und die christliche, keine Rolle in seinen Betrachtungen, obwohl sie doch per definitionem selbst wesensgleich mit der Moral sind. Nagel beschränkt seine Überlegungen bewusst auf die säkularen Ausprägungen der menschlichen Moral, wohl wissend, dass das Phänomen der (menschlichen) Moral selbst transzendente Züge aufweist, die auf einen säkularen Ersatz der Religion(en) verweisen.
Eine der zentralen Fragen dieses Buches lautet, ob es einen „moralischen Realismus“ im Sinne ewiger, unumstößlicher moralischer Werte gibt, den die Menschen „nur“ erkennen müssen, oder ob die Moral selbst ein Werk des Menschen und damit – beliebig? – an die jeweiligen Umstände anpassbar ist. Nagel verweist auf die Naturwissenschaften als exemplarisches Beispiel eines von der menschlichen Erkenntnis unabhängigen Sachverhalts. Gravitation und Fliehkraft auf der Erde und im Universum lassen sich von den Menschen nicht beliebig variieren. Man kann naturwissenschaftliche Erkenntnisse zwar für gute wie für schlechte Zwecke nutzen, aber nicht negieren.
Nagel ordnet der Grundauffassung der Moral entsprechende Wertbegriffe zu. Der moralische Realismus kennt nur „falsch“ und „richtig“, während die menschengemachte Moral nach „gut“ und „schlecht“ unterscheidet, das heißt, nach dem Urteil der sie definierenden Menschen. Auch ohne Bezug auf die Religionen gibt es einen weit verbreiteten moralischen Realismus bis tief in das westliche Wertesystem hinein. Der Wunsch nach „richtig“ und „falsch“ ist dabei verständlich, da gerade moralisch engagierte Menschen bei einer von Menschen entwickelten Moral beliebige Anpassungen an welche auch immer herrschende Verhältnisse fürchten. Nagel selbst hätte den Antisemitismus anführen können, der im Dritten Reich ungeachtet seiner tausendjährigen menschlichen Ausdeutung zur absoluten Wahrheit erklärt wurde. Gerade mit diesem Wissen im Hintergrund ist der philosophische Drang nachvollziehbar, ein transzendentes, vom Menschen zu erkennendes, aber nicht änderbares Moralsystem zu postulieren. Das Problem für eine säkulare Philosophie ist dabei jedoch die Instanz, die diesen Wertekanon erstellt (hat).
Nagel ordnet den beiden konkurrierenden Ansichten eindeutige Begriffe zu. Das „richtig“ und „falsch“ des moralischen Realismus bezeichnet er als „deontologisch“, was bedeutet, dass diese Werturteile nichts mit den Konsequenzen „richtiger“ und „falscher“ Handlungen zu tun haben. Eine moralisch „richtige“ Handlung kann dabei zu katastrophalen Folgen (für die Menschen) führen, während eine „falsche“ sich für die Gattung Mensch vorteilhaft zeigen kann. Damit ist ein solches transzendentes Moralsystem von vornherein unabhängig vom Menschen, den man im transzendenten Sinne sogar als vernachlässigbar betrachten kann. Dagegen achtet der „konsequentialistische“ Ansatz auf „gute“ oder „schlechte“ Folgen – für den Menschen – und hat sich im philosophischen Begriff des Utilitarismus zu einer Handlungsmaxime entwickelt, die jede Handlung nach ihren Folgen (für den Menschen) bewertet.
Anhand dieser gegenläufigen Entwicklungen diskutiert Nagel eingehend den Begriff des moralischen „Fortschritts“, wobei sich natürlich die Frage stellt, ob es diesen überhaupt geben kann. Ein deontologisches Moralsystem wird einen moralischen Fortschritt rundweg ablehnen, weil er den menschlichen Einfluss postulieren würde. Doch wäre eine stufenweise Erkenntnis des ewig wahren Moralsystems möglich, das heißt: nicht die Moral schreitet fort, sondern die Erkenntnis des Menschen.
Nagel diskutiert diese widerstreitenden Weltsichten an mehreren Beispielen wie der Abschaffung der Sklaverei und der Gleichberechtigung der Frauen, die über Jahrhunderte undenkbar gewesen wären und sich doch durchgesetzt haben, und kommt am Ende zu der vorsichtigen Einschätzung einer menschengemachten Moral mit all ihren Risiken. Er ist sich zwar der Fallstricke dieser „relativen“ Moralauffassung bewusst, sieht aber offensichtlich in einer transzendenten Instanz keine Alternative,
Wer sich für diese Grenzbetrachtungen der Gattung Mensch interessiert, sollte sich unbedingt in diesen kleinen Band vertiefen. Allerdings sollte man nicht davon ausgehen, dass um die hundert Seiten schnell zu lesen seien.
Das Buch ist im Suhrkamp-Verlag erschienen, umfasst 111 Seiten und kostet 23 Euro.
Frank Raudszus

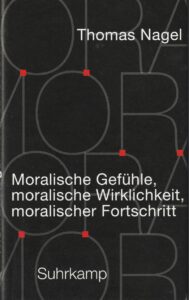
No comments yet.