In seinem Roman „Allegro Pastell“ von 2019 erzählt der 1983 geborene Autor Leif Rand von einer alternativen Berliner Literatur- und Kunstszene der um die 30-jährigen, die die individuelle Freiheit und Unverbindlichkeit der Beziehungen zu ihrer Lebensform erkoren haben.
In seinem neuen Roman „Let’s talk about feelings“ geht es um das Lebensgefühl der um die 40-jährigen, wiederum in der Berliner Szene. Diesmal aber bewegen sie sich in der Welt der Mode, der Clubs und Diskotheken, man interessiert sich für angesagte Lebensstile und Musiktrends.
Der Roman ist aus der Sicht des 41-jährigen Protagonisten Marian Flanders erzählt, allerdings in der dritten Person, was eine gewisse Distanz zu dieser Figur erzeugt.
Marian besitzt die Herren-Boutique „Kenting Beach“ in Berlin-Schöneberg. Das Markenzeichen des Ladens ist exklusive, hochpreisige Mode von bekannten Designern. Marian führt das Geschäft aus Leidenschaft für gute Kleidung. Nachdem er keinen Platz für ein Modestudium erhalten hat, hat er Kunstgeschichte und Soziologie studiert, um schließlich einen Master in „Curatorial Studies“ abzulegen. Dennoch hat es ihn wieder zur Mode hingezogen. Als Sohn des in den 70er Jahren sehr bekannten Models Caroline Flanders ist für ihn die Kleidung der Menschen ein Herzensanliegen. Seine Kunden will er bestens beraten und ihnen zu einem Kleidungsstil verhelfen, der zu ihnen passt. Solange seine Mutter lebt, gehen die Geschäfte gut, denn sie unterstützt ihn regelmäßig. Sie hat ihn alleine großgezogen hat und ist bis zuletzt seine Beraterin, deren Urteil ihm immer sehr wichtig ist.
Auch sein Vater ist ein bekanntes Gesicht in der Öffentlichkeit, war er doch über zwei Jahrzehnte Sprecher der Tagesthemen. Entsprechend wird Marian häufig über seine Eltern definiert, was ihn bisweilen verunsichert.
Der Roman beginnt mit dem Tod der Mutter. Für Marian kommt nur eine alternative Beerdigung in Frage: eine Seebestattung auf dem Wannsee auf einem ausgedientem Partyschiff. Anschließend lädt er in einen früheren Ballsaal, hier soll es gute Stimmung geben, es darf auch getanzt werden.
Das entspricht seinem bisherigen Lebensstil. Er bewegt sich intensiv in der Clubszene, sein Leben ist nach außen gerichtet. Dazu gehört der regelmäßige, aber kontrollierte Drogen- und Alkoholkonsum, der offenbar in der Schickeria ganz normal ist. Nach der Trennung von seiner Freundin genießt er die Freiheit und Unverbindlichkeit seiner zwischenmenschlichen Beziehungen. Wichtig ist ihm die Selbstdarstellung, seine äußere Erscheinung hat immer Stil und ist dem jeweiligen Anlass gemäß sorgfältig ausgewählt.
Er kennt viele Menschen, begegnet allen mit der gleichen Liebenswürdigkeit. Zu seinem Vater und seinen zwei Halbgeschwistern Teda und Colin hat er losen, aber durchaus freundlichen Kontakt. Eine gute Männerfreundschaft führt er mit dem Werbetexter Piet, aber auch das geht deshalb so gut, weil man sich gegenseitig gelten lässt und nicht in ein Konkurrenzverhältnis gerät. Gefühle zeigt man in dieser Welt eher nicht, vorgetragene Coolness ist offenbar überlebenswichtig.
Durch den Tod der Mutter ändert sich seine Haltung grundsätzlich. Sie war offenbar der einzige Mensch, mit dem ihn eine tiefe Beziehung verband. Bei seiner Traueransprache wird er von den eigenen Gefühlen überrascht, die ihn immer wieder ins Stocken geraten lassen und die inszenierte Fröhlichkeit als falsch entlarven. Er klinkt sich daraufhin über mehrere Wochen aus dem Party-Leben aus, auch sein Geschäft überlässt er im Wesentlichen seinen Mitarbeiterinnen.
Die Krise macht ihn nachdenklich, ob er das Leben so weiterführen will oder ob er noch einmal etwas ganz Neues beginnen will. Um ihn herum binden sich die Menschen, seine Ex ist schwanger, sein Freund verliebt sich in seine als CD-Jockey international erfolgreiche Halbschwester Teda. Für ihn dagegen endet eine anfangs hoffnungsvolles Date im Desaster.
Leif Rand zeigt mit Marian eine Figur seiner eigenen Generation. Sein Thema ist das inszenierte Leben, das sich in seiner zur Schau getragenen Coolness als sehr brüchig erweist. Wird Marian übrig bleiben, wenn sich die Menschen um ihn herum binden? Denn die sich nach außen sehr freizügig gebende Frau, die er durchaus begehren könnte, erweist sich als widersprüchlich: Sie lebt in einer konventionellen Ehe, an der sie auch festhalten wird.
Marian ist ein Mensch der inneren Widersprüche. Er liebt die Freiheit und Ungebundenheit, die ironisch-distanzierte Sprache, die auf einem Code von meist anglizistischen Sprachhülsen beruht, mit dem man sich austauscht, ohne zu viel von sich preiszugeben. Er spürt jedoch, dass er damit zunehmend auf ein Abstellgleis gerät, und sucht das authentische Gespräch. Da kommt ihm der neue Podcast „Let’s talk about feelings“ seines Freundes Piet sehr gelegen. Ob man allerdings in einem Podcast wirklich über eigene Gefühle sprechen kann, ist die Frage. Ist dieses Format nicht auch wieder eine Inszenierung für die Öffentlichkeit, bei der man nur so tut, als ob man authentisch ist?
Für Marian steht Veränderung an, im Privaten wir im Geschäftlichen. Wird es ihm gelingen, mit der jungen Regisseurin Kuba eine stabile Beziehung aufzubauen?
Auch geschäftlich muss er sich neu orientieren. Bisher hält er an dem Bild des engagierten Einzelhändlers fest, dessen fester Kundenstamm sich ihm als Verkäufer anvertraut. Das aber entspricht nicht mehr den neuzeitlichen Verkaufsstrategien. Das Geschäft dümpelt vor sich hin, solange er sich nicht dem Online-Geschäft und neuen Werbestrategien öffnet. Dazu benötigt er den Impuls der Jüngeren.
So ist „Let’s talk about feelings“ auch ein Roman über das Älter-Werden. Der inzwischen 42-jährige muss sich fragen, in welche Richtung das Leben in der zweiten Hälfte gehen soll. Zum Glück kann er sich inzwischen vorstellen, dass auch das durchaus interessant sein kann.
In diesem Roman wird viel gesprochen. In Dialogen mit dem besten Freund, mit dem Vater, mit der Freundin der Mutter, mit der Halbschwester geht es immer wieder um die Frage der richtigen Entscheidungen im Leben. Abbrechen und neu anfangen? Oder festhalten und das weiter voranbringen, an dem man gearbeitet hat?
So wird der Roman zur Diagnose unserer Zeit, in der wirtschaftliche und politische Zustände diskutiert werden, in der die eigenen Ängste durch neue Zukunftshoffnungen relativiert werden. Diese 40-jährigen lassen sich schließlich von den jungen Frauen zu neuen Ansätzen beflügeln, ohne dabei in falsche Jugendlichkeit zurückzufallen. Für Marian ist es ein Weg zum späten Erwachsen-Werden.
Leif Rand erzählt diese Geschichte mit großer Leichtigkeit, mit Witz und gleichzeitig einem melancholischen Unterton. Der Roman ist sowohl für die Generation im mittleren Lebensalter lesenswert als auch für Ältere, denen vieles aus dem Szene-Leben und der Musikwelt der Jüngeren fremd erscheinen mag.
Dass dieser Roman einen englischen Titel hat, hat mich anfangs irritiert. Aber das ist aus dem sprachkritischen Ansatz Leif Rands nur konsequent. Zeigt er doch, wie das Deutsche durch die hybride Sprache dieser Generation geradezu dekonstruiert wird. Ist es nicht schon normal geworden, dass wir „sorry“ statt „Entschuldigung“ sagen, dass der Bundeskanzler sagt „whatever it takes“, dass es „midterm sale“ heißt statt „Ausverkauf“? Leif Rand hält uns Leserinnen und Lesern den Spiegel vor zu unserem eigenen Sprachverhalten, aber ohne zu urteilen.
Wie Marian Flanders müssen wir entscheiden, wohin wir gehen wollen.
Insgesamt ist das ein kurzweiliger, gut zu lesender Roman, dessen verborgener Tiefsinn erst bei intensiverem Nachdenken sichtbar wird.
Leif Rand, Let’s talk about feelings. Verlag Kiepenheuer & Witsch, 320 Seiten, 24 Euro.
Elke Trost

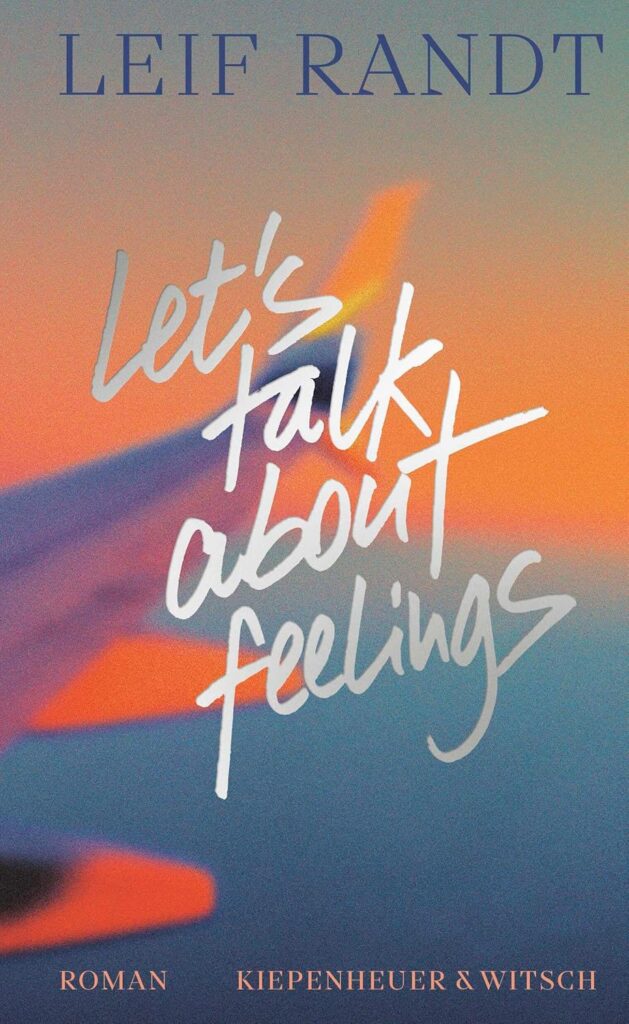
No comments yet.