Das Autorenteam beschäftigt sich an der Universität Amsterdam schwerpunktmäßig mit Migrationsfragen. Mithilfe eingehender Recherchen und Umfragen im EU-Raum haben sie einen umfangreichen Datenbestand sowohl zur Migrationsstruktur als auch zu den Einstellungen der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund erstellt, der die Grundlage des vorliegenden Buches mit dem Untertitel „Leben in der Superdiversität“ bildet.
Dabei haben sie festgestellt, dass in den meisten europäischen Großstädten bereits sogenannte „Mehrheitsminderheiten“ existieren, bei denen die Bewohner ohne Migrationshintergrund nur noch über eine relative Mehrheit verfügen. Die Tatsache, dass die migrantische Bevölkerung die Mehrheit stellt, wird in ihrer Bedeutung nur dadurch relativiert, dass die Minderheiten selbst heterogen sind und daher über keine gemeinsame Basis verfügen. Leider weisen die Autoren nicht aus, welchen prozentuale Rolle dabei EU-Migranten spielen oder ob sie überhaupt mitgezählt werden. Durchgängig ist nur von „ohne Migrationshintergrund“ und „mit Migrationshintergrund“ die Rede.
Das muss im wissenschaftlichen Sinne zwar kein Defizit darstellen, spielt jedoch bei den Schlussfolgerungen eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Denn die Autoren stellen aufgrund der Zahlenverhältnisse lakonisch fest, der „ohne“-Teil der Bevölkerung könne nicht mehr erwarten, dass sich die Migranten an die Lebensart und Werte der aufnehmenden Gesellschaft anpassen, sondern dass die Integrationsanstrengungen zumindest zu gleichen Teilen von beiden Seiten erfolgen müssen. Weiterhin haben sie detailliert die Einstellung der „eingesessenen“ Einwohner zur Migration erfragt und sind dabei auf zum Teil paradoxe Sachverhalte gestoßen. So sieht ein bedeutender Anteil der Befragten Migration und deren Vielfalt positiv, während ein ebenfalls signifikanter Anteil die Migration und deren Folgen kritisch sieht oder sogar ablehnt. Weitere Nachfragen haben dann jedoch ergeben, dass von letzteren ein signifikanter Anteil ein durchaus gutes Verhältnis zur migrantischen Nachbarschaft und sogar persönliche Freundschaften pflegt. Die Autoren deuten dies – wohl zu Recht – als pragmatische Lebenseinstellung, der es in erster Linie um einen friedlichen Alltag geht. Der nicht vernachlässigbare Anteil derer, die ihre Abneigung auch ins Persönlich-Alltägliche übertragen, muss dann mit einem hohen emotionalen Alltagsstress leben. Auf der anderen Seite können viele der Migrationsfreunde nicht auf eigene migrantische Nachbarschaft oder gar auf einen entsprechenden Freundeskreis verweisen.
Die Autoren schließen aus diesen Erkenntnissen, dass es dem gedeihlichen Zusammenleben und einer gemeinsamen Zukunft dient, wenn sich auch die nicht-migrantischen Kreise aktiv um Kontakte und Bindungen kümmern. Sie richten sogar fünf Handlungsempfehlungen an die nicht-migrantischen Einwohner für ein gutes Miteinander: gemeinsame Organisation der Alltagsabläufe, aktive Kontaktaufnahme zu Migranten (etwa bei Elternabenden), Einbringen als aktive „Brückenbauer“ zu den Migranten, Nutzung von Schlüsselpositionen (Arzt, Pfarrer, etc.) für die Gemeinschaft, Entwicklung von Gemeinschaftsräumen und Treffpunkten.
Das klingt alles durchaus logisch und nachvollziehbar, und man könnte an dieser Stelle aus voller Überzeugung den Ausführungen des Autorenteams zustimmen, wären da nicht ein paar große Leerstellen.
Dass viele Freunde der migrantischen Vielfalt selbst keine engen Kontakte pflegen, wundert die Autoren, ist aber leicht zu erklären. Meist rekrutieren sich die Migrationsfreunde aus dem akademischen Umfeld, und dort sind die – außereuropäischen! – Migranten kaum vertreten. EU-Migranten sind – auch nach eigener Erfahrung des Rezensenten – durchaus in die Freundeskreise eingebunden. Dasselbe gilt für fehlende berufliche Kontakte. Wenn ein Großteil der Migranten in Deutschland nur geduldet ist und nicht arbeiten darf, ergeben sich keine Gelegenheiten zu persönlichen Kontakten, und Ähnliches gilt für den ebenfalls großen Anteil der Anerkannten, der nur über geringe Qualifikationen verfügt. Erstaunlicherweise erwähnen die Autoren diese Erklärung gar nicht – auch nicht als eine eventuell falsche! -, sondern unterstellen eine innere Scheu oder gar Abwehr auf Seiten der Migrationsbefürworter. Gerne verweisen die beiden auch auf die einfache Kontaktaufnahme am Rande des Fußballplatzes, sei es bei eigenem Sport oder bei dem der Kinder, ohne zu beachten, dass Fußball nicht im gleichen Maße in allen gesellschaftlichen Schichten und Altersklassen gespielt wird.
Der schwerwiegendste Einwand gegen die Sicht dieses Buches auf die Migration liegt jedoch in der Aussparung der systemkritischen Migrationsaspekte. So suggerieren die Autoren in ihren eigenen Ausführungen und den Antworten auf Befragungen, dass der größte anzunehmende Kontrast bei der Lebensart in der Haltung zur Homosexualität liege. Ansonsten scheint es lediglich um Hautfarbe, Essensgewohnheiten und Sprache zu gehen. Phänomene wie Islamismus, Dschihad, Frauenbild – Kopftuch, Burka, Hausarrest -, Ehrenmorde und kriminelles Clan-Wesen werden nicht etwa marginalisiert, sondern kommen schlicht nicht vor. Damit wird die ganze Migrationsproblematik in Europa auf ein etwas anderes Nachbarschaftsverhältnis reduziert, das sich mit ein wenig gutem Willen leicht lösen lässt.
Guter Wille ist zwar stets zu loben und zu fordern, und damit ist den Autoren unbedingt Recht zu geben, aber er reicht nicht, um die Spannungen zwischen grundsätzlich widerstreitenden Auffassungen über Würde, gegenseitige Achtung und den Stellenwert der Religion aufzulösen. Die Ausführungen dieses Buches sind an keiner Stelle explizit falsch oder gar gefährlich, sie reichen nur nicht, um das Problem zu beschreiben und zu lösen. Nur die „Gut-Fälle“ allein als Maßstab zu nehmen, ist zwar verständlich, aber zu wenig.
Das Buch ist im Verlag C. H. Beck erschienen, umfasst 191 Seiten und kostet 16 Euro.
Frank Raudszus

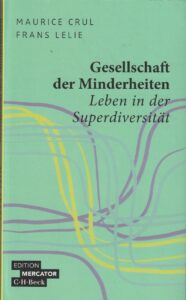
No comments yet.