Zurecht hat die Schweizer Autorin Dorothee Elmiger für ihren Roman „Die Holländerinnen“ den Deutschen Buchpreis 2025 erhalten. „Die Holländerinnen“ ist ein kluges, anspruchsvolles und gleichzeitig verstörendes Buch, das mich so gefesselt hat, dass ich es kaum zur Seite legen konnte.
Dieser Roman ist ein Bericht über die Vortragsreihe einer bekannten und erfolgreichen Schriftstellerin. Geplant ist, dass sie über ihren neuen Roman sowie über ihre literarische Methode und ihre Literaturtheorie spricht. Bei der Vorbereitung zweifelt sie jedoch, ob sie sich überhaupt auf ihren Text wird konzentrieren können, denn das gerade Geschriebene scheint ihr immer gleich wieder zu entgleiten, weil sich andere Ereignisse und Erlebnisse vordrängen.
Sie hat sich drei Jahre zuvor auf ein Projekt eingelassen, das sie in den Regenwald des Amazonasgebiets verschlagen hat. Ein Theatermacher möchte sich mit einem ganzen Theaterteam auf die Spuren von zwei jungen Holländerinnen machen, die 10 Jahren zuvor im Amazonasgebiet verschwunden sind. Er ist besessen von der Idee, dass das Theater authentisch die Erlebnisse und möglichen Gefühle der Protagonisten eines Stückes nachvollziehen müsse, dass deshalb alle Beteiligten dieselben Erfahrungen selbst machen müssten. Er nennt das den „hypnotischen Realismus“. Die Aufgabe der Schriftstellerin ist es, als Protokollantin alles, was geschieht, festzuhalten. Ihre Aufzeichnungen sollen dem Theatermacher später als Material dienen. Die Vortragende traut jedoch häufig ihren eigenen Aufzeichnungen nicht, sind sie doch oft im Nachhinein aus der Erinnerung, bei schlechtem Licht, oft nur als Satzfetzen entstanden, die sie später kaum entziffern kann. Alles, was wir hören, steht unter Vorbehalt, vieles ist Legende, Mythos, Erzählung. Die Wahrheit lässt sich nicht überprüfen
Kurz vor Beginn der Vortragsreihe beschließt sie eine Planänderung und konfrontiert ihr Publikum mit ihren Aufzeichnungen.
Alles, was wir erfahren, wird jedoch aus der Perspektive einer dritten Person erzählt, die offenbar an der Vortragsreihe teilgenommen hat. Diese Erzählerfigur erlebt die Vortragende als eine Person, die sich zunehmend in ihre Regenwalderfahrungen versenkt und nur kurz von Zeit zu Zeit ihr Publikum wahrnimmt, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob ihre Zuhörer überhaupt aufmerksam sind.
Diese Erzählerfigur geht auf Distanz zu dem Vortrag, vermittelt den Eindruck, dass man der Vortragenden nicht trauen kann, denn der ganze „Bericht“ ist in der indirekten Rede gehalten. Das erinnert sofort an Thomas Bernhards „Kalkwerk“, hat aber auch Bezug zu Walter Benjamin. Die Vortragende zitiert dazu den Theatermacher, der wiederum Benjamin zitiert, bei dem es zu Nikolai Lesskow heiße, die Figur des Erzählers sei „uns etwas bereits Entferntes und weiter sich noch Entfernendes“. Für den Theatermacher habe sich daraus die Frage ergeben, „ob man sich in diesem Sinne nicht auch die Holländerinnen als Erzählerinnen denken könne, … deren Spuren sich im Dickicht des Urwaldes verlören“. Diese Erzählstruktur ist so selbst ein Moment der Unsicherheit, denn es bleibt offen, wer eben diese Erzählfigur ist. Dass man ihr auch inhaltlich nicht trauen kann, haben wir schon gesehen. Die Wahrheit scheint sich ebenfalls im Dickicht des Urwalds zu verlieren.
Durch diese raffinierte Berichtstruktur hat der Roman mehrere Zeitebenen, die des Vortrags, die der Ereignisse im Regenwald und die Zeitebenen der verschiedenen Geschichten, die in der Runde der Teilnehmer erzählt werden, wie um ihre Furcht vor der magischen Macht des sie umgebenden Urwalds zu bannen.
Gleich zu Beginn wird das Thema angeschlagen, das den Theatermacher bewegt habe. Ihm sei es um die Grundproblematik der Dialektik der Aufklärung gegangen: um den Umschlag von Aufklärung in neue Herrschaft. Der Theatermacher habe dazu den Beginn von Adornos „Dialektik der Aufklärung“ zitiert, den er auswendig habe sprechen können: „Seit je hat Aufklärung im umfassenden Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils.“
Dorothee Elmiger geht es um den Antagonismus von Zivilisation und Kultur einerseits und der Natur andererseits. Welches Unheil die aufgeklärten und zivilisierten Europäer angerichtet haben, lässt sich leider nur zu gut an der Kolonialgeschichte Südamerikas aufzeigen. Die hat vielleicht den Herrschenden die Furcht genommen, aber die Beherrschten in Angst und Schrecken versetzt. Aber die Furcht vor der Undurchdringlichkeit des Urwalds konnten auch die neuen Herren nicht abschütteln. Damit wird der Urwald zur Metapher für die existenzielle Furcht des Menschen vor allem, was sich nicht erklären lässt.
Das Besondere der geographischen Lage des Ortes verweist auf einen weiteren Bedeutungszusammenhang. Hier, es scheint Kolumbien zu sein, erstreckt sich der Urwald unmittelbar bis an den Pazifik. Entsprechend ist der Blick aufs Meer, der Licht und Weite bedeutet, eine Metapher für die Befreiung aus dem Dickicht. Sobald das Meer sichtbar wird, ist die Rettung nahe.
Wie Unterdrückung, Brutalität und Gewalt bis heute auf allen gesellschaftlichen Ebenen des menschlichen Zusammenlebens präsent sind, zeigen die verschiedenen Geschichten. Wir hören von gewalttätigen Beziehungen zwischen Mann und Frau, von der Gewalt der spanischen Eroberer gegen die indigenen Bewohner, von der Gewalt gegenüber Tieren, von Demütigungen und Unmenschlichkeit. Alle Geschichten schildern den Umschlag unserer Aufklärung in Barbarei.
Die Vortragende berichtet von Geschichten, die sie entweder selbst erlebt hat oder von anderen gehört hat, die oftmals diese Geschichten wiederum nur vom Hörensagen kennen. Alles bleibt im Unklaren, was wahr ist und was Legende, bleibt offen. Entsprechend ist die indirekte Rede die logische Erzählhaltung. Wo Aufklärung sein will oder soll, bleibt der Mythos. Dieser menschengemachten Welt steht die ursprüngliche Welt des Regenwalds gegenüber. Seine Undurchdringlichkeit erzeugt Furcht, die „brodelnde“ Natur wird als magisch erlebt, in der das Lebendige sich ungehindert Raum schafft. Die Vortragende berichtet von diesen Erfahrungen, wie sie sich ausgeliefert gefühlt habe, immer wieder die Zuflucht bei den Menschen und deren Geschichten gesucht habe, obwohl diese Geschichten von bedrohlichen Ereignissen handeln.
Dennoch verliert der Roman nicht den Faden. Immer wieder kehrt die Erzählerfigur zurück zur Realität des Vortrags. Diese Passagen stehen folglich im Indikativ, denn das Einzige, was in dieser ganzen Erzählung real ist, ist die Tatsache des Vortrags selbst. Inhaltlich aber ist die Vortragende sprunghaft und assoziativ. Halt findet sie in ihrer Erzählung an der Dokumentation des zeitlichen Ablaufs der Reise, die Tage werden genau festgehalten, das scheint in ihren Protokollnotizen zu stimmen. Festhalten kann sie sich ganz konkret auch an ihrem Rednerpult und an ihren Notizblättern.
Dorothee Elmiger lässt die Vortragende ihre umfassende Bildung zur Schau stellen. Da werden Adorno und Horkheimer, Hannah Arendt und Walter Benjamin zitiert, sie verweist auf Merleau-Ponty und Didier Eribon, auf die Filmemacher Herzog und Coppola, auf Thomas Bernhard und Robert Walser, um hier nur einige zu nennen. Die Leser und Leserinnen sind gut beraten, einige Autoren zu kennen, um diese Bezüge zu verstehen.
So entsteht ein Roman über die althergebrachte Rolle des Geschichtenerzählens, wie wir sie von Scheherezade oder dem Decamerone kennen. Erzählen, eben Literatur, hilft besonders in Extremsituationen, zu verstehen und die Furcht zu bannen. Und befinden wir uns nicht heute in furchterregenden Zeiten, in denen wir Geschichten dringend benötigen? In diesem Sinne ist der Roman ein Plädoyer für die Notwendigkeit gerade von solcher Literatur, die uns herausfordert, die uns Widerstand bietet, uns zum Mitdenken herausfordert.
Mein Dank gilt einer großen Autorin, die mich gefordert und so gefesselt hat, dass ich den Roman gleich ein zweites Mal studiert habe. Auch eine dritte Lektüre wird sicher noch zu neuen Erkenntnissen führen.
Dorothee Elmiger, Die Holländerinnen. Hanser Verlag, 161 Seiten, 23 Euro.
Elke Trost

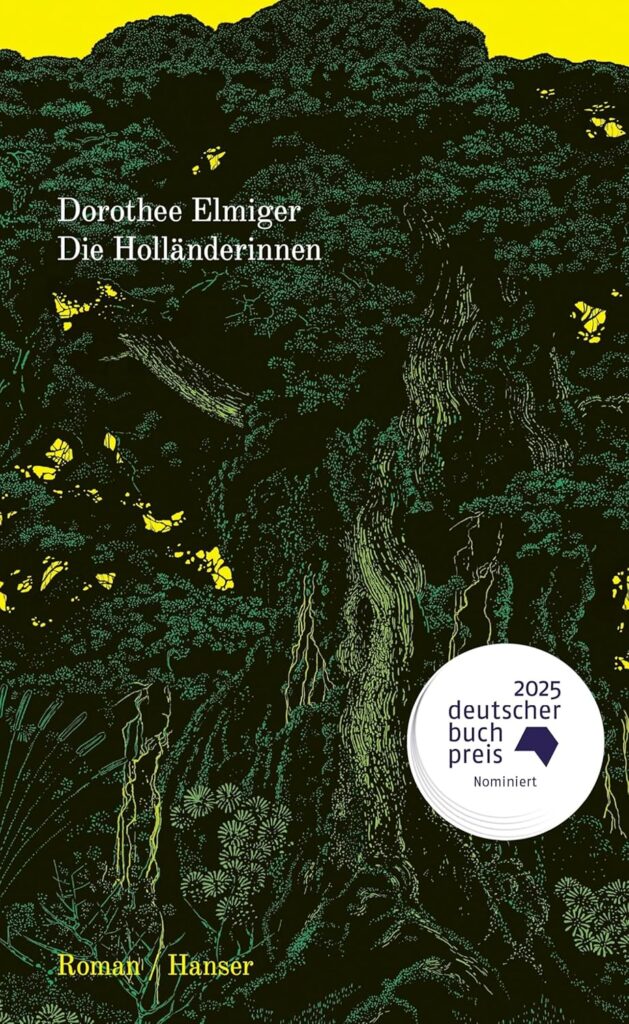
No comments yet.