Der Autor dieses Buches ist Biologe und emeritierter Professor für Naturschutz. Bei einem so bedeutungsschwangeren Titel, der auf die eigene Gattung abhebt, kann man also annehmen, dass hier weniger Philosophie oder gar Ideologie, sondern Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse eine zentrale Rolle spielen. Dennoch verzichtet der Autor nicht auf den normativen Aspekt seiner Ausführungen, wohl wissend, dass diese Spezies nicht irgendeine Nische füllt, sondern sich im wahrsten Sinne des Wortes die „Erde untertan gemacht hat“. Also muss man neben Vergangenheit auch Gegenwart und Zukunft mit einbeziehen, und das durchaus mit einem normativen Hintergrund.
Reichholf hat sein Buch in drei Teile gegliedert: In „Mensch werden“ beschreibt er die Entstehung der Gattung, wobei es um Millionen von Jahren geht. In folgenden Kapitel „Mensch sein“ widmet er sich dem gegenwärtigen Menschen, wobei diese Gegenwart in zehntausenden von Jahren verortet ist. Im letzten Kapitel, „Mensch bleiben“ wagt Reichholf dann einen vorsichtigen Ausblick in die Zukunft, eher skeptisch denn spekulativ, denn weder naiver Optimismus noch Apokalyptik scheint bei diesen Betrachtungen angemessen.
Im ersten Kapitel verwirft Reichholf viele tradierte Vorstellungen über den Frühmenschen, etwa den Grund für die Entwicklung des aufrechten Ganges und den Auszug in die Savannen. Seine Erläuterungen sind dabei stets von einleuchtender Logik und zeigen, dass die Wissenschaft hier tatsächlich Fortschritte gemacht hat. So wurde der Frühmensch nicht durch Nahrungsknappheit aus dem Wald in die Savanne getrieben, sondern folgte den aufgrund des damaligen Klimawandels zu großen Wanderungen gezwungenen Großtieren zwecks proteinreicher Nahrung. Auch die Ausbreitung der Frühmenschen nach Asien und Europa ist bei Reichholf nicht der Wanderlust geschuldet, sondern hatte handfeste, will sagen überlebenstechnische Gründe. Bei all diesen neuen Erkenntnissen weist Reichholf auf die zwangsläufig knappe weil fossile Faktenlage hin, die stets zu einem gewissen Anteil von Spekulation in der Interpretation führt. Allerdings folgt seine Argumentation stets dem gegenwärtigen Erkenntnisstand und minimiert dadurch den spekulativen Aspekt.
Da sieht es im zweiten Teil schon etwas besser aus, der – ganz grob – mit der letzten großen Eiszeit einsetzt. Reichholf beschreibt die Ausbreitung des Homo Sapiens und die Verdrängung der anderen Frühmenschen – Neandertaler – durch seine höhere Intelligenz, die eng mit der nur dem „Sapiens“ eigene Sprache zusammenhängt. Daraus entwickelt er neue Erkenntnisse über gesellschaftliche Strukturen wie etwa das Patriarchat, das er weniger ideologisch als „nur“ logisch herleitet, ohne es deshalb apologetisch in die Gegenwart zu extrapolieren. Auch die Sexualität spielt dabei eine zentrale Rolle, nicht nur für die Fortpflanzung selbst – banal“`! – sondern auch für den sozialen Bestand der durch die sexuelle Gender-Asymmetrie geprägten Gattung. Auch der Übergang zur Sesshaftigkeit mit allen sozialen und gesellschaftlichen Folgen, etwa der Arbeitsteilung, dem stark verbesserten Nahrungsangebot und dem ökonomischen Überschuss wird detailliert analysiert.
Im dritten Teil beschreibt und deutet Reichholf den historischen Homo Sapiens, der die ihm auf Gedeih und Verderben ausgelieferten Ressourcen der Erde dank seiner überlegenen Intelligenz zum eigenen Nutzen verbraucht und durch die Steigerung sowohl der Lebenserwartung als auch der überlebenden Nachkommenzahl immer größere Vorkommen benötigt. Reichholf erliegt zwar nicht der Gefahr, den moralischen Zeigefinger zu erheben, macht jedoch unmissverständlich deutlich, dass der Mensch auf dem besten Wege ist, sich selbst die Lebensgrundlagen zu entziehen. Allerdings sieht er in der seit Jahrmillionen bewiesenen menschlichen Fähigkeit, sich an andere Umweltbedingungen anzupassen, eine durchaus gegebene Wahrscheinlichkeit, dass die Gattung Mensch auch die gegenwärtigen Krisen – Klimawandel, Überbevölkerung, Kriege – überstehen wird. Andererseits weist er ausdrücklich auf das Phänomen hin, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, dass die eigene Art bis zur Vernichtung bekämpft, nicht um der Nahrung, sondern um der bloßen Macht willen.
In diesem Buch gelingt dem Autor das Kunststück, den schmalen Grat zwischen seriöser wissenschaftlicher Argumentation und einem apokalyptisch angehauchten Moralismus nie zu verlassen. Man fühlt sich von seinen Ausführungen informativ bereichert, doch nie belehrt.
Das Buch ist im Hanser-Verlag erschienen, umfasst 350 Seiten und kostet 27 Euro.
Frank Raudszus

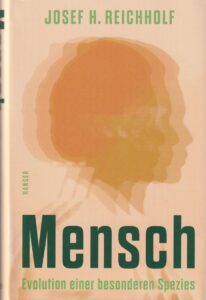
No comments yet.