Eine streitbare Schrift gegen populäre politische Forderungen.
Schon das Motto der französischen Revolution „Liberté – Égalité – Fraternité“ wird bis heute von einer großen Fraktion gerne im Sinne einer materiellen Gleichheit aller Menschen verstanden. Diese Forderung erhebt vor allem die extreme Linke in allen „kapitalistischen“, sprich: marktwirtschaftlichen Gesellschaften. Dabei braucht man im Grunde nur auf die Reihenfolge der drei Forderungen zu schauen, um zu erkennen, das „Liberté“ an erster Stelle steht….
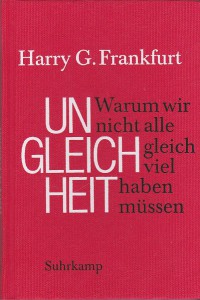 Harry G. Frankfurt, emeritierter Philosophie-Professor Autor der Princeton und mit seinen mittlerweile 85 Jahren immer noch intellektuell auf dem Stand der Diskussion, wurde unter anderem bekannt durch sein provokantes Buch „Bullshit“, in dem er die sinnleere Sprache der Werbung und des Marketings entlarvte. In dem vorliegenden Buch geht er mit der Forderung vieler Linker ins Gericht, alle Menschen müssten über gleiche Einkommen verfügen.
Harry G. Frankfurt, emeritierter Philosophie-Professor Autor der Princeton und mit seinen mittlerweile 85 Jahren immer noch intellektuell auf dem Stand der Diskussion, wurde unter anderem bekannt durch sein provokantes Buch „Bullshit“, in dem er die sinnleere Sprache der Werbung und des Marketings entlarvte. In dem vorliegenden Buch geht er mit der Forderung vieler Linker ins Gericht, alle Menschen müssten über gleiche Einkommen verfügen.
Gleich zu Beginn stellt er klar, dass Ungleichheit große Ungerechtigkeit zur Folge haben kann und auch im wohl begründeten Fall, beseitigt werden müsse. Er misst jedoch der Gleichheit selbst kleinen intrinsischen, d. h. von äußeren Einflüssen unabhängigen moralischen Wert bei. Nicht der unterschiedliche Wohlstand sei der Skandal, sondern die Armut selbst. Unabhängig von der Definition der Armut, die er hier nicht diskutiert, misst er der existenziellen Armut, die ein nach vernünftigem Ermessen menschenwürdiges Leben verhindert, einen negativen moralischen Wert bei. Wenn alle über ausreichende Mittel für ein „gutes Leben“ verfügen, spiele es keine Rolle, ob einzelne mehr oder weniger verdienen. Natürlich sieht er die Vagheit des Begriffs „menschenwürdiges Leben“, unterstellt dabei jedoch aus guten Gründen zweierlei: (a) es ist möglich, ein gemeinsames Verständnis darüber zu gewinnen, und (b) innerhalb dieses gefundenen Rahmens gibt es eine breites Spektrum von individuellen Vorstellungen, die der „Rasenmäher“ der totalen Gleichheit nicht berücksichtigen kann. Die Forderung nach totaler Gleichheit ziehe stets den Vergleich mit anderen Menschen nach sich, das heißt, die Vorstellungen eines „guten“ Lebens hängen nicht von subjektiven, individuellen Neigungen und Fähigkeiten ab, sondern von der Lebensführung anderer Mitmenschen.
Doch Frankfurt greift auch wissenschaftliche Beweisführungen an, mit denen selbst bekannte Ökonomen die Pflicht zur Gleichheit quasi zur rationalen Pflicht hochstilisieren wollen. Darunter fällt zum Beispiel die Theorie vom sinkenden Grenznutzen, der besagt, dass jeder zusätzlich verdiente Dollar dem Betreffenden weniger Nutzen bringen als die vorher verdienten. Die Geld-/Nutzenfunktion sei schlicht nicht linear, und wenn der einzelne Dollar „unten“ mehr bringe als „oben“, sei die Forderung nach Gleichheit eine gesamtwirtschaftlich zwangsläufige Konsequenz. Frankfurt entlarvt diese Theorien als nicht nur nicht stichhaltig sondern als geradezu falsch und beweist an mehreren exemplarischen Fällen, dass der Nutzen durchaus linear oder sogar nichtlinear steigen könne. Über eine eventuelle moralische Wertung dieses Mehrnutzens sagt er nichts, aber das steht bei der ökonomischen Debatte auch nicht zur Debatte.
Immer wieder betont der Autor jedoch, dass er durchaus den Skandal absoluter Armut und auch andere negative Folgen unterschiedlicher Einkommen sehe. Diese ließen sich aus seiner Sicht jedoch durch jeweils gezielte Maßnahmen beseitigen. Der Grund liege nicht inhärent in der „Ungleichheit“ der Einkommen. Im zweiten Teil geht er sogar auf die Ungleichheit in der Achtung der individuellen Menschenwürde ein und gesteht sogar ein, dass diese auch durch starke Ungleichheit der Einkommen bedingt sein könne. Doch dann müsse man die Gründe dafür suchen und diese direkt beseitigen. Dazu könne eine größere Umverteilung durch Steuern durchaus beitragen, Gleichheit selbst sei jedoch kein moralisch höher stehender Ansatz, sondern oftmals nur eine geradezu irrationale Forderung, die sich populistisch leicht vermarkten lasse.
Den Begriff des „Neides“ vermeidet Frankfurt bewusst, wie auch die Verfechter der Gleichheit. Jene möchten auf keinen Fall in die Nähe dieser allgemein als kleingeistig geächteten Charaktereigenschaft gerückt werden, und die Gegner wie Frankfurt wollen die Unterstellung vermeiden, man greife den politischen Gegner sozusagen „unter der Gürtellinie“ auf der persönlichen Ebene an. Dennoch kann man durchaus der Meinung sein, dass der Neid bei der Forderung nach Einkommensgleichheit eine große Rolle spielt. Hat doch eine einschlägige Untersuchung in Deutschland vor einigen Jahren ergeben, dass die meisten Deutschen sich mit weniger Einkommen zufrieden geben würden, wenn nur der Nachbar nicht mehr hätte….
Harry G. Frankfurts kleines Buch von nur rund 100 Seiten liest sich erfrischend und gut verständlich und ist in der Lage, einige ideologische Verspannungen zu lösen, soweit entsprechend „vorgespannte“ Leser dies überhaupt zulassen. Es ist im Suhrkamp-Verlag erschienen und kostet 10 Euro.
Frank Raudszus

No comments yet.