„Sehr geehrte Frau Ministerin“, der neue Roman von Ursula Krechel, ist ein durch und durch feministischer Roman. Es geht um die gesellschaftliche Rolle der Frau in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Im Vergleich von Frauenfiguren in der Gegenwart mit starken Frauen der Antike setzt sich Ursula Krechel mit den strukturellen Problemen auseinander, die sich aus der Macht der Männer und der Unterlegenheit der Frauen ergeben.
Starke Frauen werden von der Geschichtsschreibung häufig marginalisiert, ihre Geschichten werden uminterpretiert, oft werden sie ganz ausradiert.
Ursula Krechel entwickelt ein raffiniertes Erzählkonzept, um die Verhältnisse in der Gegenwart mit denen der römischen Antike zu Zeiten Kaiser Neros zu verknüpfen. Das hört sich sehr künstlich an und wirft die Frage der Plausibilität dieses Konzepts auf. Ich will versuchen, diese Frage zu beantworten.
Worum geht es konkret?
Im Mittelpunkt stehen drei Frauen im mittleren Lebensalter zwischen 40 und 50. Wir lernen zuerst Eva Patarak kennen. Sie ist Fachverkäuferin für Kräuter, Tee und allerlei gesundheitsfördernde Substanzen. Sie lebt mit ihrem 25-jährigen Sohn Philipp in einer kleinen Wohnung und bringt beide mit ihrem bescheidenen Gehalt durch. Der Sohn verbarrikadiert sich hinter seinem Computer, hat die Uni geschmissen, die er „Massentierhaltung“ nennt. Was er an seinem PC tut, weiß die Mutter nicht. Er schließt sie aus seiner Welt ganz aus.
Eva hat gerade einen Historienfilm über Agrippina, die Mutter, die „optima mater“, des römischen Kaisers Nero gesehen. Damit ist das Thema „Mütter und Söhne“ zeitübergreifend angeschlagen. Erzählt wird zunächst in der 3. Person über Eva. Die Leserin stutzt, als aus der 3. Person plötzlich die 1. Person wird und Eva über sich selbst erzählt.
Erst bei weiterer Lektüre wird klar, wie das zu verstehen ist. In den Laden kommt regelmäßig die Frau „mit der roten Mütze“, die ab und zu etwas kauft, etwa eine Lotion, die den Haarwuchs befördert. Irgendwann kommt Eva der Verdacht, dass sich diese Frau mehr für ihr Leben interessiert als für Heilkräuter und dass sie über sie schreibt. Dagegen will sie sich mit einem Brief an die Justizministerin wehren. Der Brief bleibt jedoch als Entwurf liegen.
Im zweiten Teil „ab ovo“ schildert die Frau mit der roten Mütze in der 1. Person, wie sich diese Beziehung von Anfang an, also „ab ovo“, entwickelt hat. Sie ist Studienrätin für Latein und Sport. Es gibt zwar einen Freund, bzw. einen dann „Nicht-mehr Freund“, der mehr auf Forschungsreisen in Südamerika ist als bei ihr. Auch sie lebt also allein. Sie hat gerade eine Krebserkrankung überwunden, das bringt sie in die Kräuterhandlung. Die Erkrankung hat sie sehr aus der Bahn geworfen, weil ihr Alltag durch überstarke Blutungen behindert worden ist. Auch in der Schule gibt es Auseinandersetzungen über ihre Tacitus-Lektüre mit 10-Klässlerinnen, die von einer Mutter wegen der Darstellung brutaler Kriegsereignisse kritisiert wird.
Sie, Silke Aschauer, ist ihrer Weiblichkeit im doppelten Sinne ausgeliefert, einmal ihrem Körper und zum anderen der starken Umwelt, gegen die sie alleine dasteht. Ihre Rettung findet sie im Schreiben. Die Kräuterfrau ist für sie der Aufhänger, über Frauenschicksale nachzudenken. Sie erfindet für die Verkäuferin den Namen Eva, den Namen der „Urfrau“ der Bibel, und gleichzeitig deren Geschichte. Sie installiert sie als Ich-Erzählerin. Das erklärt den Wechsel von der 3. Person zur 1. Person. Als Altphilologin ist sie mit der römischen Geschichte bestens vertraut und kennt ihren Tacitus. Daraus erklärt sich ihr Erzählansatz. Sie parallelisiert die Geschichte der einfachen Kräuterverkäuferin im heutigen Essen mit der Geschichte der in der nordischen Colonia Agrippinensium, dem heutigen Köln, geborenen Agrippina.
Das verbindende Element der beiden Frauen ist die Mutter-Sohn-Beziehung, die Wandlung von der „optima mater“, die alles erdenklich Gute für den Sohn tut, zur abgelehnten, verachteten und – im Falle Agrippinas – zur zu vernichtenden Hassgestalt.
Die Lateinlehrerin Silke Aschauer erkennt ein Muster hinter den Frauenschicksalen. Frauen dürfen nicht stark werden, nicht stärker sein als die Söhne. Sie müssen von der Bildfläche verschwinden, auf welche Weise auch immer, um den Sohn nicht einzuschränken. Beide sind Opfer einer männlichen Welt, wenn auch auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Eva wird von nun auf jetzt gekündigt, der Laden aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Die grüne Gesundheitsverklärung erweist sich als Mythos, der so lange benutzt wird, wie das Geschäft läuft. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wird die Idee mit dem Laden entsorgt. Die betroffenen Frauen spielen dabei keine Rolle.
Mythisierung ist auch der Hintergrund der Geschichtsschreibung. Frauen werden groß gemacht, solange sie nicht die Männerwelt bedrohen. Ist das der Fall, werden neue Geschichten über sie erzählt, aus den Opfern werden Täterinnen, neue Mythen der Rechtfertigung von Gewalt gegen Frauen entstehen, heute wie damals.
Diese Erkenntnis ist für die Autorin Silke Aschauer wie ein Befreiungsschlag, Im Schreiben über Frauen kommt sie selbst aus der Opferrolle heraus, sie selbst bestimmt die Handlung, kann frei gestalten, Geschichte gegen den Strich lesen. Sie wird jetzt zur „Täterin“, aber zu schriftstellerischen, die die Geschichte selbst bestimmen kann.
Immer wieder erkennt sie die Blutspur in der Geschichte der Frauen, auch in der Geschichte der mutigen keltischen Königstochter Boudica, die die englischen Truppen gegen die Römer anführt. Ihre Niederlage ist dann der Grund, falsche Erzählungen über sie auf den Weg zu bringen, um sie schließlich fast ganz aus der Geschichte zu entfernen.
Blutig ist die Geschichte der Frauen, Blut ist entsprechend eine durchgehende Metapher in diesem Roman, auch die Farbe Rot, etwa in der „roten Mütze“ der Erzählerin. Sie steht für die Opferrolle, das Ausgeliefert-Sein der Frau an die Blutungen, die entweder ihr Körper produziert oder aber die Außenwelt.
Bleibt das letzte Kapitel „als ob“: Die Lateinlehrerin will die Erlaubnis einholen, über die Justizministerin zu schreiben. Ihre Anfrage versackt irgendwo in den Mühlen des Ministeriums. Sie schreibt dennoch, nicht nur über die Ministerin, sondern auch über die Geschichte des Gebäude, in dem sich das heutige Justizministerium befindet. Auch diese Geschichte ist eine Geschichte von männlicher Macht und Unterdrückung. Die Justizministerin will dagegen ein deutliches Zeichen setzen. Sie will den „Rechtsstaat stärken“, wie sie auf Wahlveranstaltungen verspricht – „als ob“ das so leicht wäre. Darin liegt wohl die Bedeutung der zunächst etwas rätselhaften Kapitelüberschrift.
Mit der Erzählung über die Justizministerin, die zerrissen ist zwischen Familie und Politikgeschäft, weitet die Erzählerin ihr Thema noch einmal aus. Die Frau in der Politik sieht sich der besonderen „Überwachung“ durch das Wählervolk ausgeliefert. Kann sie es schaffen? Kann sie sich durchsetzen? Und wie geht es dabei den armen Kindern und dem armen Ehemann? Dass diese Fragen keinem Mann gestellt werden, braucht die Erzählerin, bzw. Ursula Krechel, nicht zu erwähnen, das weiß die Leserin ohnehin.
Auch die Ministerin wird schließlich zum Opfer, auch hier wird Blut fließen, auch hier wird die Legendenbildung folgen.
Wie sich der Kreis von der Geschichte der Ministerin zur Geschichte der Eva Patarak am Ende schließt, soll hier nicht verraten werden. So viel nur: die erzählende Lateinlehrerin hat sich das gut überlegt.
Eine Einschätzung dieses sehr komplexen und raffiniert erzählten Romans ist so kompliziert wie der Gegenstand selbst. Was einerseits künstlich wirkt, der ständige Wechsel zwischen Gegenwart und Antike, liest sich gleichzeitig hochspannend und lädt ein, sich mehr mit antiker Frauengeschichte zu befassen. Ursula Krechel trägt viel Wissen zusammen, sie zeigt, wo sich Mythos und Geschichtsschreibung überschneiden, wo Geschichte verfälscht wird, wo Sprache für ideologische Machtansprüche missbraucht wird, so dass die Leserin ständig auf neue Fragestellungen hingeführt wird. Das betrifft auch die neuere Geschichte im Zusammenhang mit dem Justizministerium.
Ich sehe den Roman als ein großes Plädoyer für uns Frauen, den Mut nicht zu verlieren, uns nicht immer wieder in die Opferrolle und in althergebrachte Rollenmuster drängen zu lassen, sondern mutig unsere eigene Geschichte zu erzählen.
Der Roman zeugt von großem Wissen der Autorin, insofern ist er durchaus auch elitär, denn eigentlich muss man sich seiner Lateinkenntnisse erinnern, um wirklich Freude an den sprachlichen Raffinessen zu haben.
Ich kann den Roman nur sehr empfehlen, insbesondere in einer Zeit, in der starke Bewegungen sich gegen das Rollenmodell der selbstbestimmten Frau wenden. Insofern ist das auch ein kämpferisches Buch.
Ursula Krechel, Sehr geehrte Frau Ministerin. Verlag Klett-Cotta, 368 Seiten, 26 Euro.
Elke Trost

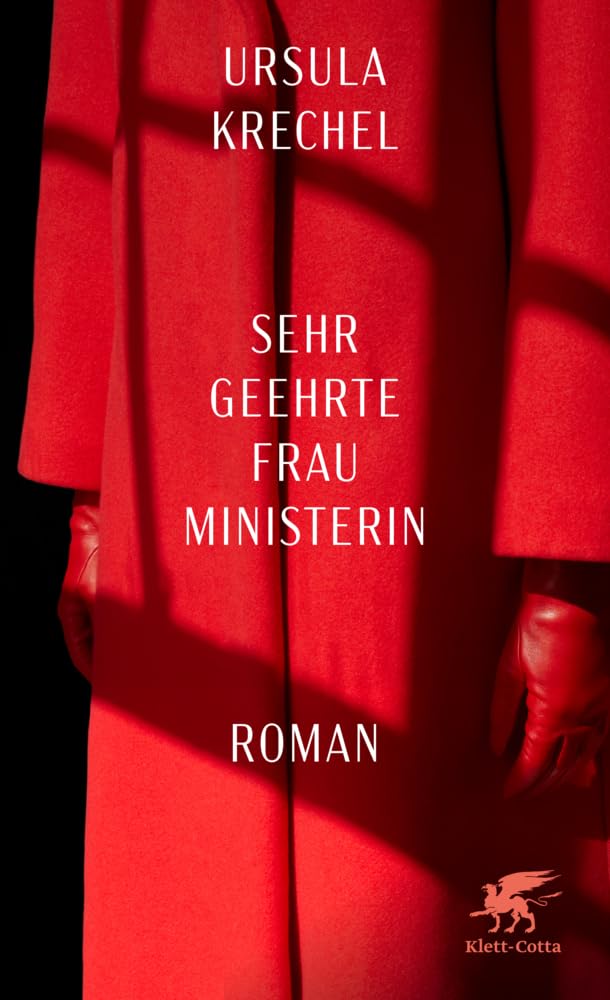
No comments yet.