Vielen Leserinnen und Lesern ist Sebastian Haffner (1907 – 1999) bekannt als Autor des Buches „Geschichte eines Deutschen, die Erinnerungen 1914 -1933″. Haffner schildert hier, wie er selbst die zunehmende nationalsozialistische Indoktrination erlebt hat, nicht zuletzt in einem Fortbildungslager für junge Juristen. Er schildert sehr eindringlich, wie er selbst die Verführungskraft von Gemeinschaftsritualen und der Beschwörung neuer Männlichkeit gespürt hat und wie schwierig es war, sich davon abzugrenzen.
Haffner hat sich schon früh aus der Juristerei zurückgezogen, weil er nicht als Jurist in einem Unrechtsstaat arbeiten wollte. Stattdessen hat er sich als Publizist auf politikfernen Gebieten, wie z.B. der Modebranche, betätigt. 1938 ist er nach Großbritannien emigriert. Hier hat er 1939 mit der Niederschrift von „Geschichte eines Deutschen“ begonnen. Er veröffentlichte es unter dem Pseudonym Sebastian Haffner in Verehrung für Bach und Mozart. Den Namen behielt er bis an sein Lebensende bei, seinen Geburtsnamen Raimund Pretzel legte er ab. Das Buch erschien in vollständiger Fassung im Jahr 2000 in Deutschland.
Nun haben die Erben den frühen Roman „Abschied“ freigegeben, den Haffner, noch als Raimund Pretzel, bereits 1931 geschrieben hat, jedoch nie veröffentlicht hat. Welch Glück, dass dieses kleine Meisterwerk im Nachlass gefunden wurde, das nun im Hanser Verlag erschienen ist.
Der Roman ist, was wir heute einen autofiktionalen Roman nennen. Die Hauptfigur ist der Ich-Erzähler Raimund Pretzel, der im Jahr 1931 seinen Urlaub als Rechtsassessor dazu nutzt, seine große Liebe Teddy in Paris zu besuchen.
Raimund hat die verwöhnte, aber rebellische Teddy in Berlin kennen und lieben gelernt. Teddy aber beschließt, ihrer übergriffigen, konservativen Familie zu entfliehen und zum Studium nach Paris zu gehen. Bei seinem Besuch in Paris erlebt Raimund alle Höhen und Tiefen des Verliebt-Seins. Teddy lebt in äußerst beengten studentischen Verhältnissen, verdient sich etwas Geld mit Übersetzungsarbeiten. Zu Raimunds Überraschung ist sie ganz in das Bohème-Leben am Boulevard Saint-Michel eingetaucht. Bei ihr geben sich die verschiedensten Verehrer die Tür in die Hand. Sie alle erliegen ihrem Charme und ihrem Esprit. Für Raimund sind die zwei Wochen entsprechend ein Wechselbad der Gefühle: Von Eifersucht geplagt, kann er die beschworene Romantik der Berliner Tage nicht wiederherstellen. Gleichzeitig fasziniert ihn die Weltoffenheit und Lebendigkeit von Paris. Berlin erscheint dagegen provinziell und ohne wirkliche Lebensart.
Der Roman beginnt am vorletzten Tag von Raimunds Paris-Aufenthalt. Die ihm verbleibende Zeit ist schon vom Schatten des Abschieds getrübt. Aber auch der Rückblick auf die zurückliegenden zwei Wochen ist äußerst ambivalent. Die Freude über das Wiedersehen wechselt mit dem Gefühl des unglücklichen Liebhabers, der mit der Konkurrenz der Verehrer nicht mithalten kann. Diese jungen Leute reden über Gott und die Welt, sie trinken und rauchen ununterbrochen, natürlich Gitanes, man frotzelt, macht sich gegenseitig an, konkurriert um die Aufmerksamkeit der jungen Frau.
Aber man redet auch über Politik. In den Köpfen der jungen Deutschen geht es widersprüchlich zu. Da genießen sie einerseits die freie Pariser Lebensart, gleichzeitig wünscht man sich den Krieg herbei. Einer möchte aus Frustration über ein Missgeschick mit dem Flammenwerfer alles anzünden. „Der Franzose“ bleibt der Erzfeind. So spuken nationalistische Ressentiments in diesen Köpfen herum, obwohl man sich gleichzeitig gerne weltläufig, modern und aufgeklärt gibt. Finanziell sind sie sehr unterschiedlich ausgestattet. Einige können sich das studentische Bohème-Leben leisten, weil der Wechsel von den Eltern mit Sicherheit kommt. Andere halten sich mit Gelegenheitsjobs, etwa als Statisten im Theater, über Wasser.
Es scheint, dass diese jungen Leute die Orientierung verloren haben und in den Tag hineinleben. Raimund sieht sich in dieser Gesellschaft als Außenseiter, der eine ordentliche juristische Ausbildung hinter sich hat und nun als Referendar einem ganz normalen Arbeitsalltag nachgeht, in dem es heißt, Plädoyers vorzubereiten, Urteile zu begründen etc.; damit ist er finanziell einigermaßen unabhängig und kann sich diesen Paris-Urlaub leisten, wenn auch auf niedrigem Niveau.
Dieser letzte Tag ist ein sich dehnender Abschied, Raimunds Zug wird erst abends um 10 Uhr abfahren. Die gemeinsamen Stunden mit Teddy allein werden immer weniger, denn irgendjemand kommt immer noch einmal kurz vorbei. In diesen letzten Tag soll dann noch alles hineingestopft werden, was Raimund in den zwei Wochen versäumt hat: Der Eiffelturm, der Louvre mit der Venus von Milo und der Kreuzigung von Greco, das Pantheon, das Grab Napoléons, Montmartre, Montparnasse, Sacré-Cœur. Das geht natürlich alles gar nicht. Aber es kommt zwischen den beiden noch zu sehr viel Nähe im Louvre und auf dem Eiffelturm, den die beiden in der beginnenden Dämmerung erleben.
So glücklich Raimund einerseits in diesen wenigen Stunden ist, so weiß der doch, dass der bevorstehende Abschied ein endgültiger sein wird. Zu weit ist er in seiner eigenen Lebensform schon von der Teddys entfernt. Auch ist er sich der Gefühle Teddys keineswegs sicher. Für sie scheint das Leben ein Spiel zu sein, für ihn ist es ernst.
Haffner taucht mit diesem kleinen Roman ganz in die Welt dieser jungen Leute ein und gibt uns als Leserinnen einen unmittelbaren Eindruck von dem Lebensgefühl Anfang der 30er Jahre, in denen sich trotz aller scheinbaren Leichtigkeit und Unbesorgtheit der jungen Leute schon ein Gefühl einer düsteren Zukunft ausdrückt.
Bemerkenswert ist, wie er das Spiel zwischen Teddy und Raimund schildert. Hier frotzelt man übereinander, macht Andeutungen, aber keine eindeutigen Gefühlsaussagen, als hätten beide Angst, sich zu offenbaren. Lieber verstecken sie sich hinter Wortspielen und den uns allen aus Kindertagen bekannten nein-doch-nein-doch Kabbeleien, die sich unendlich fortführen lassen.
Sebastian Haffner gelingt ein sensibles Psychogramm der Jugend in einer Epoche, die kommendes Unheil schon ahnen lässt.
„Abschied“ ist ein unbedingt lesenswerter Roman, der uns Nachgeborenen einen weiteren Einblick in die Epoche unmittelbar vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten gibt.
Sebastian Haffner, Abschied. Hanser Verlag 2025, 192 Seiten, 24 Euro.
Elke Trost

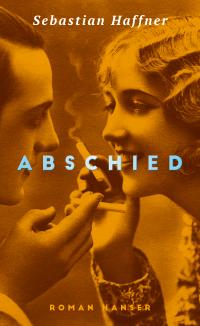
No comments yet.