Im Anschluss an die Lektüre von Juri Felsen „Getäuscht“ entschloss ich mich, nun endlich „Die Falschmünzer“ von André Gide zu lesen. Der Roman lag schon länger auf dem Stapel unbedingt zu lesender Bücher. André Gide (1869 – 1951) gehörte seit den 1920er Jahren zu den Großen der französischen Literaturszene. Er hat Juri Felsen stark beeinflusst.
Der Roman „Die Falschmünzer“ erschien 1925 in Paris, die erste deutsche Übersetzung von Ferdinand Hardekopf erfolgte 1928. Ich habe das Buch in der 1996 bei dtv erschienenen Neuübersetzung von Christine Stemmermann gelesen. Dieser Band enthält im Anhang André Gides hochinteressante Tagebuchnotizen und Briefe, die die Entstehungsgeschichte des Romans dokumentieren und reflektieren.
„Falschmünzer“ ist die zentrale Metapher des Romans. Gide entlarvt in seinem Figurenkaleidoskop aus der besseren Pariser Gesellschaft die Diskrepanz zwischen äußerem Schein und innerer Wahrheit. Fast alle seine Figuren tragen ein Geheimnis mit sich herum, oder sie belügen ganz bewusst ihre Umwelt oder auch sich selbst. Insofern sind sie alle Falschmünzer. Der reale Hintergrund für diesen Ansatz ist eine spanische Falschmünzer-Bande, die Jugendliche zum Verteilen von falschen Goldmünzen missbraucht hat. Der Roman spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor dem ersten Weltkrieg.
Die Hauptfigur ist der Schriftsteller Edouard, um die 40, der sich mit einem neuen Roman herumschlägt. Titel dieses Romans soll „Die Falschmünzer“ sein. Damit ist schon früh klar, dass Edouard viele Züge seines Autors trägt. Edouard ist ein Philanthrop, dem es insbesondere um die Förderung begabter junger Menschen geht. Eine Begegnung zwischen Edouard und seinem Neffen Olivier am Bahnhof offenbart die große Zuneigung der beiden füreinander. Beide jedoch haben so große Furcht, ihre Gefühle vor dem anderen zu entdecken, dass die Begegnung für beide zur Enttäuschung wird. Damit ist schon zu Beginn des Romans das Thema Homosexualität angeschlagen. Ob Edouard sich selbst wirklich zugibt, dass seine homosexuelle Neigung auch ein Motiv für seinen Altruismus ist, bleibt offen. Insofern gehört auch Edouard zu den „Falschmünzern“.
Die beiden weiteren Hauptfiguren sind die etwa 17- jährigen befreundeten Abiturienten Olivier und Bernard.
Bernard entdeckt kurz vor dem Abitur, dass er nicht der leibliche Sohn seines offiziellen Vaters ist, und verlässt Hals über Kopf das sehr angesehene und wohlhabende Elternhaus. Zuflucht findet er für eine Nacht bei seinem Freund Olivier. Schon zu Beginn wird klar, dass Olivier sinnlich von Bernard angezogen ist, während Bernard wirklich nur die Freundschaft sieht.
Um diese drei Hauptfiguren spinnt Gide ein Netzwerk von Beziehungen, das Einblick in die Abgründe familiärer und gesellschaftlicher Strukturen gibt. Ein Gegenspieler des Philanthropen Edouard ist der Comte de Passavant, ein sehr reicher, zynischer und skrupelloser Mann, der sich über alle Regeln hinwegsetzt, wenn es darum geht, junge Männer für sich zu gewinnen und sie mit seinem Reichtum zu verführen.
Damit ist als weiteres Thema die Frage nach der Existenz des Bösen angeschlagen. Edouard und sein alter Lehrer La Perouse diskutieren über das Teuflische im Menschen. Muss man davor Angst haben, wenn man doch weiß, dass es den Teufel nicht gibt? Dahinter steht die Frage, ob es von Natur aus böse Menschen gibt oder ob das Böse erworben ist.
Die Welt der jungen Leute, d.h. in diesem Roman der 13- bis ca. 18-jährigen, spiegelt die Welt der Erwachsenen. Auch hier gibt es den Zyniker, der hinter seinem Nihilismus seine Verzweiflung verbirgt. Er ist das Opfer einer dogmatisch puritanischen Erziehung, die in ihm nur Hass auf alles Religiöse erzeugt hat. Daneben stehen Figuren wie Bernard und Olivier, die der gutbürgerlichen Welt entkommen wollen und nach ihrer eigenen Identität und ihrer zukünftigen Bestimmung suchen, dabei auf Abwege geraten, jedoch schließlich in Edouard den Retter finden. Sie sind die empfindsamen Seelen, die sich mit Literatur befassen, selber Gedichte schreiben, in ihrer seelischen Empfindlichkeit jedoch leicht zu Opfern werden können.
Auch unter den Schülern, die noch fast Kinder sind, tritt dieser Gegensatz des Bösen und des Empfindsamen zutage. Der introvertierte Boris wird im Pensionat zum Mobbingopfer. Ein brutales Spiel des Anführers, das Boris scheinbare Anerkennung und Aufnahme in die Schüler-Clique verspricht, führt zum ungewollten Selbstmord von Boris. Auch dahinter stehen reale Ereignisse: In der Tat gab es zu der Zeit eine Häufung von Schülerselbstmorden, für deren Motive es keine wirkliche Erklärung gab.
André Gide verhandelt in seinem Roman große Themen, die zum Teil auch heute noch von beklemmender Aktualität sind. Es geht um Wahrheit und Lüge, um die Suche nach der eigenen Identität, um Dekadenz und optimistische Zukunftsperspektiven, um die Rolle der Frau und das Wesen der Ehe, um Liebe, Freundschaft, um Homosexualität. Das alles kulminiert in der Frage, wie Literatur das abbilden kann. Damit quält sich Edouard in seinem schriftstellerischen Ringen mit seinem Roman. Kann ein wahrhaftiger Roman nicht nur das darstellen, was der Autor selbst erfahren, erlebt und gefühlt hat? Und wie kann er das mit seinen verschiedenen Romanfiguren vermitteln?
Dieses Ringen um den Roman wird durch die Erzählweise selbst zum Thema. Gide spielt mit seiner Rolle als Autor und Erzähler. Er ist zum einen der beobachtende, durchaus allwissende Erzähler, der aber auch aus dieser Rolle aussteigen kann, um uns als Leser direkt anzusprechen bzw. am Schreibprozess zu beteiligen. So kann es sein, dass er sein Vorgehen kommentiert, etwa, dass er jetzt diese oder jene Figuren sich selbst überlasse, um sich anderen zuzuwenden. Wir erleben so, wie der Roman entsteht. Dieser Erzähler kann sich aber auch ganz zurückziehen und den Tagebuchschreiber Edouard sprechen lassen, der seine Erlebnisse im Tagebuch reflektiert und interpretiert. Das ist dann gleichsam eine andere Perspektive als die des Erzählers. Zu dieser Rücknahme des Erzählers gehören auch Briefe, die gelesen werden und auch weitergegeben werden und so mehrere Figuren an eigentlich intimen Geständnissen teilhaben lassen. Die theoretischen Fragen der Zeit erörtern seine Figuren im Dialog, ein weiteres Mittel gegensätzliche Positionen in die Figuren zu verlegen, so dass der Erzähler sich ganz zurücknehmen kann. Mit dieser Methode des Erzählens fordert Gide seine Leserinnen und Leser heraus. Sie müssen sich an der Diskussion beteiligen und wie seine Figuren erleben, dass es auf schwierige Fragen keine einfachen Antworten gibt.
Gides Erzählweise gilt als Wegweiser in die literarische Moderne, die die Welt nicht mehr von einem übergeordneten Standpunkt erklären kann und will, vielmehr die Leserschaft als Mitdenkende in die Verantwortung nimmt für die Gestaltung der Gesellschaft und deren Zukunft. Gide selbst gibt am Schluss seines Romans einen Ausblick auf eine Zukunft, in der sich die Hoffnung ausdrückt, dass das Gute doch auch siegen kann.
Wer den Roman noch nicht gelesen hat, sollte das unbedingt nachholen. Wer den Roman vor vielen Jahren gelesen hat, sollte ihn jetzt unbedingt noch einmal lesen. In einer Welt, in der Fake-News an der Tagesordnung sind und in der die Verführungsgewalt über junge Menschen durch die sogenannten sozialen Medien eine nie geahnte Macht gewonnen hat, ist ein Roman wie „Die Falschmünzer“ eine Aufforderung, alles zu tun, um junge Leute aus den Klauen der Verführer zu retten, wenn es denn noch möglich ist.
André Gide, Die Falschmünzer-Tagebuch der Falschmünzer, übersetzt von Christine Stemmermann. DTV Verlag 1996, 448 Seiten, gebraucht zu erwerben oder ebenfalls gebraucht von anderen Verlagen (Manesse, Anaconda) oder als E-Buch.
Elke Trost

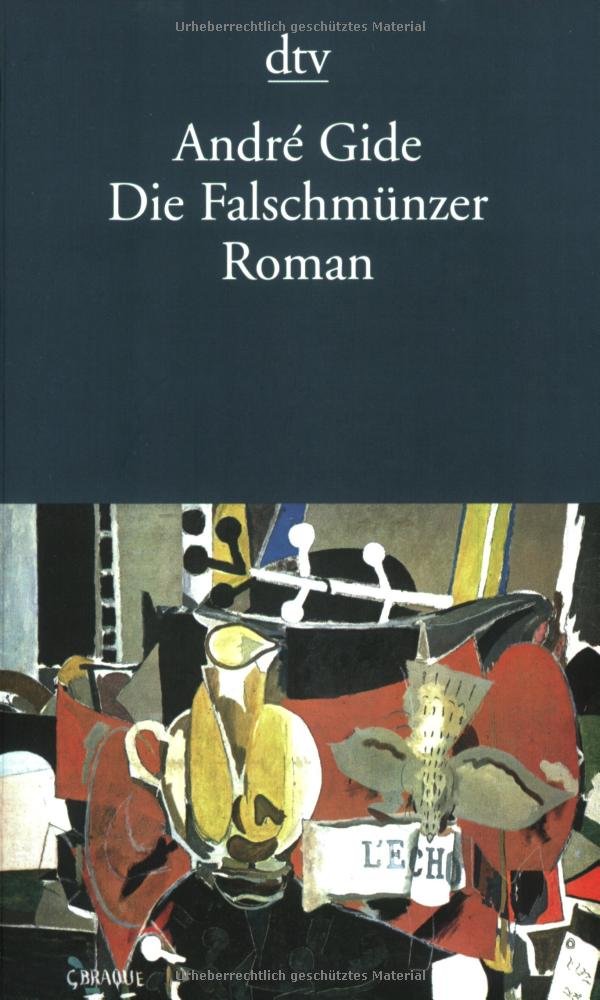
No comments yet.