Nietzsche ist einer der am meisten missverstandenen und „missbrauchten“ Philosophen, was sich besonders in der politischen Verballhornung des „Übermensch“-Begriffs durch die Nationalsozialisten zeigte. Er war ein erbitterter Gegner des christlichen Glaubens, was ihn vor allem in der restaurativen Bundesrepublik nicht gerade zu einem Sympathieträger machte.
Nun hat sich mit Christiane Tietz ausgerechnet eine Theologin, die evangelische Kirchenpräsidentin von Hessen und Nassau, in dem vorliegenden Buch dem Thema „Nietzsche und das Christentum“ gewidmet. Und sie liefert keine Abrechnung oder sophistische Widerlegung von Nietzsches Gedankenwelt, sondern beschreibt deren philosophische und biographische Strukturen in weitestgehender Sachlichkeit. Dabei geht sie chronologisch vor und analysiert anhand von Nietzsches Biographie seine intellektuelle und philosophische Entwicklung.
Der Sohn eines pietistischen Pfarrers litt schon als Kind unter langem Siechtum und frühem Tod des Vaters. Die Akzeptanz dieses Leidens durch die Mutter und Schwester im Sinne von „Gottes Wege sind unerforschlich“ konnte er schon als Jugendlicher nicht verstehen. Detailliert beschreibt Tietz seine allmähliche Entwicklung vom gläubigen Jugendlichen über den skeptischen Studenten zum erwachsenen Gegner des Christentums.
Dabei geht sie systematisch auf die einzelnen Elemente des abgelehnten Glaubens ein. Das im Christentum geforderte Mitleid entlarvt Nietzsche als moralische Selbsterhöhung der Christen, fast im Sinne eines Ablasshandels. Mit der Nächstenliebe verhält es sich ähnlich, da die professionellen Christen – zumindest zu Nietzsches Zeiten – notleidende Menschen brauchten, um an ihnen die Nächstenliebe zu praktizieren. Emanzipation und Selbstbestimmung hätte dieses christliche Geschäftsmodell zerstört. Deutlich weist Tietz vor allem auf den Komplex „Schuld und Sühne“ hin, dem Kernelement des christlichen Glaubens, demzufolge die Menschen per Erbsünde schuldig sind und auf die göttliche Gnade hoffen müssen.
Ebenso markiert die Autorin Nietzsches Ablehnung der Dualität vom Jammertal des Diesseits und vom jenseitigen Paradies. Für Nietzsches gilt nur diese eine Existenz in der uns umgebenden Welt, die nur durch uneingeschränkte Bejahung einen Sinn bekommt. Die Akzeptanz eines irdischen Leidens in der Hoffnung auf das ewige Leben im paradiesischen Jenseits empfand er als repressiv, wenn nicht zynisch. Auch sein Jesusbild richtete sich danach. Für ihn war Jesus ein ganz im Hier und Jetzt verankerter Mensch, und seine vermeintliche Gottesverwandtschaft war eine eher abstrakte, für die ein gelebtes Leben eine Art Göttlichkeit in sich trage. Für Nietzsche haben eindeutig die Jünger und Apostel die explizite ´“Sohn-Gottes“-Eigenschaft als Mythos erdacht, um bei den potentiellen Anhängern einer neuen Religion Interesse zu wecken.
Tietz schildert ausgesprochen anschaulich die langsame Entwicklung Nietzsches vom Skeptiker zu einem überzeugten Atheisten, der dennoch dem Begriff des „Göttlichen“ etwas abgewinnen konnte, jedoch nicht in der konkreten, geradezu repressiven Art des den Glauben einfordernden Christentums. Dabei vergisst sie auch biographische Elemente nicht. So litt Nietzsche sein Leben lang an schweren Schmerzen und Übelkeit, deren Diagnose im Nachhinein nicht mehr möglich ist. Dieses persönliche Leid war für ihn ein weiterer Anlass, an der gütigen Allmacht bzw. allmächtigen Güte Gottes zu glauben. Auch seine Einsamkeit spielte dabei eine Rolle. Ein so konsequenter Charakter wie er war nicht für das gesellschaftliche Amüsement geeignet, und die einzige Frau, in die er sich verliebte, Lou Andrea Salomé, gab ihm einen Korb.
Die Autorin geht den bitteren Weg Nietzsches bis zum Ende mit, verzichtet jedoch auf eine detaillierte Beschreibung seiner Geisteserkrankung, die mit philosophischem Größenwahn begann und dann in geistiger Umnachtung endete. Sie verzichtet auch darauf, seine Erkrankung in irgendeiner Weise für seine kritische Haltung gegenüber dem Christentum verantwortlich zu machen, abgesehen vom Problem des allgemeinen menschlichen Leides angesichts der angeblichen Güte und Allmacht Gottes.
Von der ersten bis zur letzten Seite nimmt die Autorin diesen Gegner ernst und folgt seiner Argumentation in einer Weise, die man fast schon als zustimmend deuten kann. Keinerlei inhaltliche Gegenargumente oder gar Widerlegung von Nietzsches Argumentation, sondern eine objektive Schilderung seiner Gedanken, und mit dem Hintergrund der realen Welt entwickeln diese Ideen ein starkes Gewicht. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Christiane Tietz mit diesem Buch eine Ehrenrettung Nietzsches verfasst hat.
Das muss ihr am Schluss selbst klar geworden sein, denn sie fügt noch einen Epilog hinzu, in dem sie Nietzsches Gedankenwelt aus heutiger – christlicher – Sicht relativiert und auf eine aktuelle, angemessenere christliche Lehre verweist. Diese deutet sie jedoch nur an, um den Epilog nicht zu einem „Anti-Nietzsche“ – im Sinne von „Antichrist“ – aufzublähen. Ihr ging es nicht um eine grundsätzliche Abwertung, sondern um die Würdigung eines großen Gegners. Und schon deshalb lohnt sich die Lektüre.
Das Buch ist im Verlag C. H. Beck erschienen, umfasst 249 Seiten und kostet 28 Euro.
Frank Raudszus

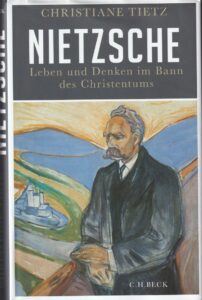
No comments yet.