In seinem 2022 erschienenen Roman „Lektionen“ blickt der britische Schriftsteller Ian McEwan am Beispiel des Lebenslaufes seines Protagonisten auf die großen Ereignisse und Fragen seiner eigenen Lebensspanne von 1948 bis in die 2020er Jahre zurück.
Sein neuer, 2025 auf Englisch und auf Deutsch erschienener Roman „Was wir wissen können“ hat eine ganz andere Perspektive. Sein Ich-Erzähler und Protagonist Thomas Metcalf, Literaturwissenschaftler an der Universität South Downs in Portsmouth, blickt aus dem Jahr 2119 zurück auf das Jahr 2014. Sein Spezialgebiet ist die europäische Literatur zwischen 1990 und 2030. Sein besonderes Interesse gehört dem berühmten, aber verschollenen „Sonettenkranz für Vivien“ des immer noch hochverehrten britischen Poeten Francis Blundy.
Blundy, damals schon Mitte 60, hat dieses Gedicht am 14. Oktober 2014 seiner Frau Vivien zum ihrem 54. Geburtstag geschenkt. Es wurde nur an diesem Abend im engsten Freundeskreis von ihm selbst vorgetragen. Es ist inzwischen zu einem Mythos der Literaturwissenschaft geworden, gilt es doch als Gipfel der Dichtkunst des 21. Jahrhunderts, obwohl es seine Berühmtheit nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda erreicht hat. Es gibt keine Kopie, auch keinerlei Notizen oder Vorarbeiten.
Der Rückblick aus dem Jahr 2119 neigt zur Verklärung der Lebensbedingungen im frühen 21. Jahrhundert: Es gab die besten technischen Möglichkeiten für die Bewältigung des Alltags und für die Fortbewegung auf dem Globus, und die Menschen scheinen intensiver und ehrlicher miteinander kommuniziert zu haben.
Das hat sich inzwischen radikal geändert. Nach mehreren atomaren Konflikten und großen Naturkatastrophen, insbesondere nach der Überflutung großer Landmassen, hat sich die Menschheit stark reduziert und durch Völkerwanderungen neu vermischt. Die biologische Artenvielfalt ist weitgehend zerstört, und die geographische Landschaft der Erde hat sich gewandelt. Große Städte, wie z.B. New York, Hamburg und Amsterdam, sind untergegangen. Statt großer, zusammenhängender Kontinente gibt es Insellandschaften und Archipele, nur die höher gelegenen Regionen sind bewohnbar geblieben.
Allerdings konnte das menschliche Wissen dank der fortgeschrittenen Digitalisierung bewahrt werden. Ein großes nigerianisches Rechenzentrum schafft die Voraussetzung dafür, dass die unendliche Menge von Daten, die die Menschen des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts hinterlassen haben, abgerufen werden kann.
Auch das Archiv der großen Bodleian Library der Universität Oxford konnte gerettet werden.
Thomas Metcalf ist entschlossen, den verschollenen Sonettenkranz zu finden. Dazu scheut er nicht vor der abenteuerlichen und nicht ungefährlichen Reise von Portsmouth nach Oxford zurück, denn er ist sicher, dass er im dortigen Archiv neue Hinweise finden wird. Er will derjenige sein, der die zahlreichen Spekulationen in der wissenschaftlichen Community über das Gedicht beenden kann, indem er den Originaltext vorlegt.
In der Auseinandersetzung mit dem Archivmaterial, d.h. mit Aufzeichnungen und Tagebüchern des Ehepaares Blundy und ihres Lebenskreises, ergibt sich für ihn ein viel differenzierteres Bild der Lebensform von Intellektuellen im 20. und 21. Jahrhundert. Offenbar konnte man sich das Leben behaglich einrichten und in einer Welt der Literatur und Poesie versinken, ohne tägliche Bedrohungen und Widrigkeiten. Das Ehepaar Blundy scheint ein beschauliches und durchaus glückliches Leben geführt zu haben, obwohl er ganz der Arbeit hingegeben war, während sie – zum Erstaunen ihrer Umwelt – die eigene wissenschaftliche Laufbahn aufgegeben hat, damit aber laut ihren Tagebucheintragungen ganz zufrieden war.
Thomas erstaunt jedoch die Ignoranz der Menschen gegenüber den sich schon damals deutlich abzeichnenden zukünftigen Umweltkatastrophen. Sie konnten alles schon wissen, haben aber nichts Entscheidendes unternommen, um die Welt zu retten.
So schwankt sein Blick zwischen Verklärung scheinbarer Idylle und kritischer Sicht. Seine wissenschaftliche Position ist schwierig, denn seine Besessenheit von dem Sonettenkranz trifft bei den Kollegen auf wenig Gegenliebe, zumal er keine sichtbaren Fortschritte vorweisen kann. Auch seine Konzentration auf den Zeitraum der Vergangenheit entspricht nicht dem wissenschaftlichen Mainstream. Die Studenten verweigern sich einem historischen Ansatz, sie wollen nicht mit der Vergangenheit belästigt werden, sich vielmehr mit den aktuellen Bedingungen ihres Lebens auseinandersetzen.
Parallel zur beruflichen Krise entwickelt sich auch seine private Beziehung problematisch. Erst ein überraschender Hinweis gibt ihm einen neuen Anstoß, noch einmal die gefährliche Reise in den „Norden“ nach Gloucester zu wagen, wohin sich die Blundys in ein kleines Dorf zurückgezogen hatten. Diese Reise, die heute mit dem Auto laut google maps in 2 ½ Stunden zu bewältigen ist, bedeutet im Jahr 2119 eine mehrtägige Tour mit Fähren und eigens gemietetem Boot. Thomas ist sicher, das Gedicht auf dem ehemaligen Anwesen zu finden.
Ian Mc Ewan erzählt dieses „literarische Abenteuer“ so packend, dass ich das Buch kaum zur Seite legen konnte. Auf unsere Gegenwart mit den Augen eines Nachfahren zu blicken, lässt uns als Leserinnen und Leser vor unserer eigenen Ignoranz erschauern!
Dennoch ist der Roman nicht dystopisch, denn die verbliebene Menschheit im 22. Jahrhundert hat sich mit ihren neuen Umwelt- und Lebensbedingungen arrangiert und findet es gut so, wie es eben ist. Es gibt keinen rebellischen Geist, vielmehr sind die Menschen schon wieder dabei, sich ihr Leben so gut wie möglich einzurichten. Wenn man will, kann man auch seine ganze Energie auf ein verschollenes Gedicht aus dem 21. Jahrhundert richten.
Nun hat der Roman allerdings noch einen überraschenden zweiten Teil, über den ich hier inhaltlich nichts verraten möchte. Nur so viel: Dieser zweite Teil stellt alles in Frage, was die Wissenschaft – und eben auch Thomas Metcalf – über das Leben der Blundys und ihres Umkreises zu wissen glaubte.
Damit wird McEwans Roman mehr als ein Roman über ein Gedicht und über Umweltzerstörung. Ein großes Thema ist die Frage von Schein und Sein: Wie stellen wir uns nach außen dar, wie wollen wir gesehen werden, und wie sind wir wirklich? In diesem Sinne ist „Was wir wissen können“ auch ein Altersroman, enthält er doch die Frage, ob wir am Ende unseres Lebens eine Art Rechenschaftsbericht ablegen und alle äußeren Masken fallen lassen müssen.
McEwan geht es aber um noch mehr. Der Titel deutet es schon an: Die Frage, was wir wissen können, impliziert die Frage, was wir nicht wissen können. Mit der Umkehrung der Zeitstruktur stellt McEwan diese Fragen auf den Kopf. Thomas weiß alles über die Zukunft des Jahres 2119, die wir nicht kennen, aber die Vergangenheit, die wir wiederum aus eigenem Erleben kennen, bleibt für Thomas unsicheres Gebiet. Die Vergangenheit wird zu einem Mosaik von Wirklichkeit, das zwar bestens dokumentiert sein mag, aber dessen Wahrheitsgehalt immer wieder zu hinterfragen ist.
Wer sich auf den Roman einlässt, muss sich auf längere Passagen zu literaturwissenschaftlichen Themen gefasst machen. Das mag für manche Leser und Leserinnen mühselig sein. Wenn man das jedoch von dem Autor her betrachtet, ist dieser Schwerpunkt nur zu verständlich, denn sein Leben ist durch die Literatur geprägt. Wenn er Rechenschaft ablegen will, dann muss es auch um die Auseinandersetzung mit der Bedeutung und Wirkung von Literatur gehen, um ihre Relevanz überhaupt.
Der Roman verweist aber auch auf andere erfüllende Lebensformen. Da gibt es z.B. den leidenschaftlichen Geigenbauer Percy, den verstorbenen ersten Mann von Vivien Blundy, der alles andere ist als ein Intellektueller. Auch Chris, der Mann der erfolgreichen Schriftstellerin Harriet Gage, gehört nicht in diese abgehobene Welt der Literaten, vielmehr ist er der handwerklich überaus geschickte Mann für alles. Er verschafft sich den Respekt von Francis Blundy, indem er dessen Bildungshochmut schlagfertig und humorig entlarvt.
Insgesamt ist auch dieser Roman wieder ein wahrer McEwan, den ich allen McEwan-Freunden nur dringend empfehlen kann. Er ist wie immer sprachlich perfekt und gleichzeitig spannend wie ein Krimi.
Ian McEwan, Was wir wissen können. Aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Diogenes Verlag, 459 Seiten, 28 Euro.
Elke Trost

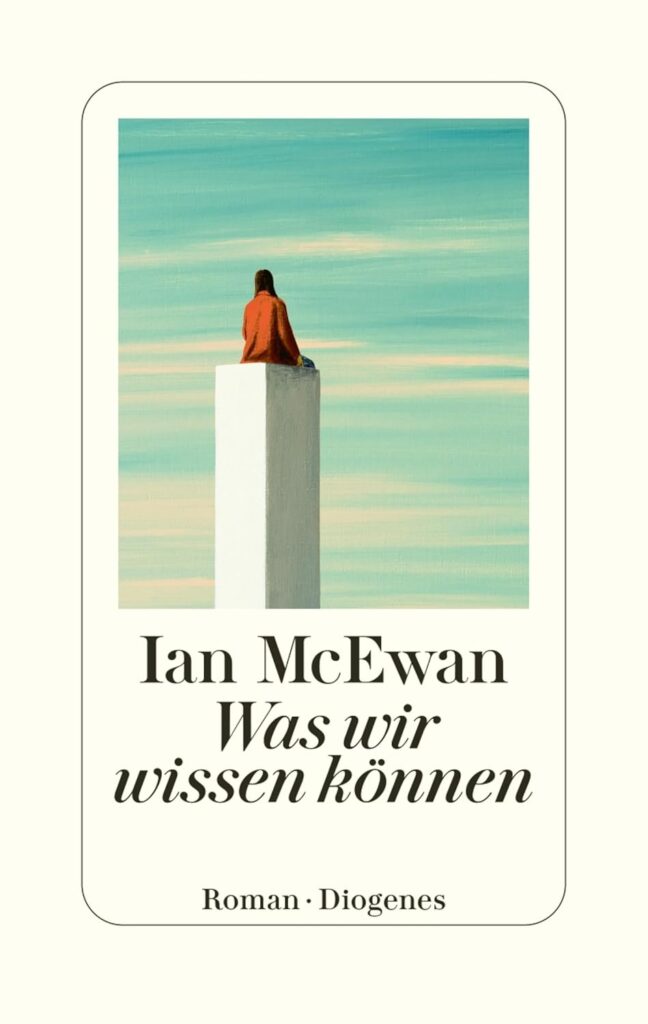
No comments yet.