Das 3. Sinfoniekonzert des Staatstheaters Darmstadt widmete sich ausschließlich der Spätromantik, oder dem „fin de siècle“, wenn man es so ausdrücken will. Zwar ragt Richard Strauss (1864-1949) aus dieser Zeit bereits deutlich heraus, doch auch seine Musik ist noch stark von dieser Epoche geprägt, wenn auch deutlich geschärft. Dagegen sind Peter Tschaikowsky und Antonin Dvorák typische Vertreter dieser Zeit und in diesem Konzert auch mit schwergewichtigen Kompositionen vertreten. Das Dirigat übernahm GMD Daniel Cohen persönlich, und als Solisten hatte man den israelischen Violinisten Vadim Gluzman gewinnen können.
Richard Strauss´ „Till Eulenspiegel“ ist im Grunde genommen eine musikalische Farce, aber von höchster Qualität. Nimmt man die runden, wohlgeformten Melodiebögen eines Brahms oder – ja! – Dvorak als Maßstab, so wirkt diese Komposition wie eine einzige Provokation des damaligen Musikverständnisses. Strauss zerpflückt förmlich das Idealbild langer, elegischer und tiefste Emotionen aufrührender Formen und ersetzt sie durch Protest und Karikatur. In diesem Sinne ist „Till Eulenspiegel“ einerseits eine Kritik an der zeitgenössischen Musik und andererseits auch wieder ihre Affirmation, in dem es sie sowohl durch die Zuspitzung der Konventionen als auch durch die musikalische Qualität bestätigt. Da werden herkömmliche Orchesterfiguren ständig unterbrochen durch plötzlich hervorbrechende schrille Einfälle und Eruptionen, vorzugsweise von den Blechbläsern oder der Oboe. Doch auch die Klarinetten und die Flöten tragen zu dieser gezielten „Kakophonie“ bei. Dass Strauss hiermit programmatisch das provokative Auftreten seiner Titelfigur beschreibt, dient nur als vordergründige Legitimation dieser Musik, tatsächlich wollte Strauss damit aber wohl die bedeutungsschwere und tiefengründelnde Musik Mahlers, Brahms´ oder Bruckners treffen, um nur einige zu nennen. Das Orchester widmete sich gerade diesen Ausbrüchen mit viel Sorgfalt und instrumenteller Transparenz und zelebrierte die quertreibenden Einwürfe mit viel Liebe zum Detail. Daniel Cohen sorgte mit markanten Gesten am Pult für die nötige Dynamik und Wucht, die jeder Art von Protest erst ihre Wirkung verleiht. Und der Spaß an dieser Provokation war dem Orchester trotz aller Konzentration deutlich anzumerken.
Tschaikowskys Violinkonzert in D-Dur, op. 35, gehört zu den großen Solokonzerten des 19. Jahrhundert, die in gewisser Weise alle auf Beethovens Violinkonzert aus dem Jahr 1806 basieren. Der vom Komponisten ins Auge gefasste Interpret erklärte es rundweg als unspielbar, und so dauerte es eine Zeitlang, ehe es zur Aufführung kam. Die Interpretation durch Vadim Gluzman zeigte deutlich den Grund für die Ablehnung des Stücks durch Violinisten. Die Bewegungen der linken, aber auch der bogenführenden Hand sind so aberwitzig schnell, dass ein nicht des Violinspiels kundiger Zuschauer nicht an die Spielbarkeit glauben könnte, hörte er es nicht in Echtzeit. Der Komponist zog alle Register des Violinspiels und hatte offensichtlich höchstes Zutrauen zu den damaligen und späteren Solisten – letztlich zu Recht. Dennoch hört sich das Stück nie „nur“ virtuos an, sondern transportiert eine breite Ausdruckspalette. Dabei spielt im ersten Satz die romantische Lust an der schönen Melodie und der Ausschmückung eine zentrale Rolle, und in der virtuosen Solo-Kadenz kann der Solist all seine außergewöhnlichen Fähigkeiten zeigen, was Gluzman ausgiebig tat, ohne sich auch nur einen Augenblick vor das Werk zu stellen. Im zweiten Satz konnte er den elegischen Aspekt der romantischen Musik voll zum Ausdruck bringen, wobei ihn die warmen Klarinetten und die anderen Holzbläser unterstützten. Der dritte Satz, „attacca“ sich aus dem Andante entfaltend, präsentierte dann noch einmal die Lebensfreude der Romantik und die außerordentlichen Fähigkeiten von Vadim Gluzman. Nachdem das Publikum bereits den ersten Satz mit Sonderapplaus bedacht hatten, folgte jetzt noch ein begeisterter Schlussapplaus, der Gluzman noch zu einer eher moderneren Zugabe getragener Art motivierte. Aber was hätte nach dem fulminanten Schluss des Violinkonzert anderes kommen können als eine nachdenkliche Zugabe!
Nach der Pause war dann die Stunde des Orchesters gekommen, das mit Dvoraks 7. Sinfonie in d-Moll noch einmal zu großer Form auflaufen konnte, ohne Rücksicht auf die zentrale Position eines Solisten nehmen zu müssen. Diese Sinfonie möchte man spontan mit dem Satz „aus Böhmens Hain und Flur“ beschreiben, obwohl dieser ein Werk von Smetana übertitelt. Doch die Sehnsucht und das Leiden unter der Vergänglichkeit durchzieht das ganze Werk, und wer immer in seinem Leben so etwas wie ein Heimatgefühl entwickelt hat, kann diese melancholische Rückschau auf etwas – vermeintlich – Verlorenes nachempfinden. Ist die Klassik von vorwärtsdrängender Aufklärung geprägt, leidet die Romantik unter dem Verlust herkömmlicher Werte, was sich vor allem in der Musik des ehemaligen Böhmens und Mährens widerspiegelt, besonders bei Dvorak. Auch die damals in Europa modische Melancholie des „fin de siècle“ dürfte dabei eine Rolle gespielt haben. Daniel Cohen und das Orchester des Staatstheaters ließen diese melancholische Grundstimmung über vier Sätze voll erblühen, aber auch das tänzerische Moment des dritten Satzes, das wie eine temporäre Befreiung aus der Schwermut wirkt. Und der Finalsatz zeigte dann eine durch die Industrialisierung aus den Fugen geratene Welt, die man aber auch als trotzige Gegenwehr verstehen kann. Das Orchester zeichnete all diese ineinander verwobenen Emotionen detailfreudig nach und vermittelte damit einen lebendigen Eindruck nicht nur der Musik, sondern auch der Lebenseinstellung des späten 19. Jahrhunderts.
Zum Abschluss dann noch einmal begeisterter, lang anhaltender Beifall des Publikums.
Frank Raudszus

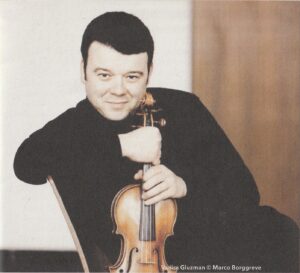
No comments yet.