Drei große „R“s der Musik des 20. Jahrhundert
Im 7. Sinfoniekonzert des Staatstheaters Darmstadt erklingt Musik von Ravel, Rachmaninow und Resphigi
Sicherlich ist den Verantwortlichen für das 7. Sinfoniekonzert die Alliteration der ausgewählten Komponisten nicht aufgefallen. Ausschlaggebend dürfte sie sicher nicht gewesen sein, aber man kann sie als originelle Zutat zu einem ansonsten gelungenen Programm betrachten, das durch die Epoche der (Hoch-)Romantik noch durch ein weiteres „R“ bereichert wurde. Alle drei Komponisten haben zwar bis weit ins 20. Jahrhundert gelebt, doch kamen sie hinsichtlich ihrer Harmonik und Klangbildung aus der Schule der Spätromantik.
Maurice Ravels „Aborado del gracioso“ weist eine komplexe Entstehungsgeschichte auf. Es entstand aus mehreren Skizzen und Klavierstücken, die sich mehr oder minder um die musikalische Beschreibung einer lustigen Person aus der spanischen Komödie – etwa „Der Barbier von Sevilla“- drehten. Ravel verleiht dem Stück neben der für ihn typischen Klangfärbung sowohl rhythmisch als auch klanglich spanischen Charakter, indem er den Klang von Gitarren und Kastagnetten nachbildet. Auch der weiche Klang des Fagotts spielt dabei eine Rolle. Wie in einer südländischen Komödie üblich, endet das Stück in einem grotesk-wilden Finale. Die programmatische Ausrichtung dieser Komposition ist unüberhörbar, und Martin Lukas Meister, der das Orchester des Staatstheaters leitete, ließ diese Chrakteristik auch deutlich in den Vordergrund treten. Wer wollte, siah hier buchstäblich den Buffo-Komödianten durch die Szene springen. Klanglich reizte Meister die Möglichkeiten des Orchesters aus und betonte den burlesken Ton.
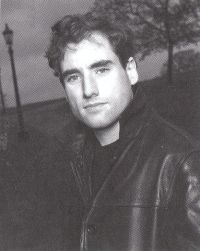 Der Schritt zum Hauptwerk des Abends war nicht nur geographisch ein großer – es ging von Frankreich bzw. Spanien nach Russland – sondern auch als musikalischer. s 2. Klavierkonzert in c-Moll betont nicht mehr das Komödiantische sondern einerseits das Heroische und andererseits das Lyrische. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die innenpolitische Situation im zaristischen Russland aufgeladen bis an den Rand der Revolution, und auch die Künstler konnten sich den Zuständen nicht verschließen. Es ist zwar immer schwierig, in der reinen Instrumentalmusik eine gesellschaftliche Aussage zu lokalisieren – und vor allem zu begründen -, aber das heroische Aufbegehren ist unüberhörbar. Schon der Beginn, den allein das Klavier mit acht akkordisch strukturierten Takten gestaltet, wirkt mit seinen sich langsam steigendernden Akkorden wie ein Aufruf zum Aufruhr.
Der Schritt zum Hauptwerk des Abends war nicht nur geographisch ein großer – es ging von Frankreich bzw. Spanien nach Russland – sondern auch als musikalischer. s 2. Klavierkonzert in c-Moll betont nicht mehr das Komödiantische sondern einerseits das Heroische und andererseits das Lyrische. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die innenpolitische Situation im zaristischen Russland aufgeladen bis an den Rand der Revolution, und auch die Künstler konnten sich den Zuständen nicht verschließen. Es ist zwar immer schwierig, in der reinen Instrumentalmusik eine gesellschaftliche Aussage zu lokalisieren – und vor allem zu begründen -, aber das heroische Aufbegehren ist unüberhörbar. Schon der Beginn, den allein das Klavier mit acht akkordisch strukturierten Takten gestaltet, wirkt mit seinen sich langsam steigendernden Akkorden wie ein Aufruf zum Aufruhr.
Als Solist trat an diesem Abend der noch junge (* 1984) israelische Pianist Boris Giltburg auf, der schon von Anbeginn durch seinen Körpereinsatz bei den ersten mächtigen – und übrigens kaum greifbaren – Akkorde beeindruckte. Den langgezogenen Melodiebögen des Hauptthemas im ersten Satz verlieh er eine vorwärtsdrängende Spannung, die bis zum Satzende nie nachließ. In langen, rollenden Wellen breitete Giltburg auf dem Flügel das Thema aus, technisch perfekt und mit einem zupackenden Anschlag, der sich auch noch gegen die mächtig dahinfließenden Orchestertutti durchsetzte. Man kann das Zusammenspiel durchaus als ein programmatisches Abbild der russischen Gesellschaft und des in ihr aufgehobenen Individuums begreifen. Die Gesellschaft – sprich das Orchester – setzt den Rahmen und zeigt das Selbstbewusstsein einer solidarischen Gemeinschaft, doch das Individuum geht in ihr nicht unter sondern meldet sich immer wieder ebenso selbstbewusst zu Wort. Erst das Zusammenspiel dieser beiden komplementären menschlichen Erscheinungsformen führt zum Kunstwerk. So wie das Klavier ohne Orchester zum Selbstzweck gerät, verliert der Mensch ohne Bezug zur Gesellschaft an Bedeutung und Lebensqualität.
Doch auch das Lyrische hat in diesem System seinen Platz. Das Klavier steht im zweiten Satz für die Innerlichkeit, und folgerichtig nimmt sich das Orchester hier deutlich zurück, um die lyrischen Melodielinien zur Geltung kommen zu lassen. Giltburg zeigte sich auch hier als Meister der Interpretation. Sein Anschlag wurde träumerisch leicht. Im Zwiegespräch mit der Flöte und später mit der Klarinette entfaltete sich das Klavier zum lyrischen Instrument, am Anfang zurückhaltend und begleitend, dann die Führung übernehmend.
Der Finalsatz bietet dem Solisten noch einmal die Möglichkeit, seine Virtuosität zu zeigen. Schnelle, weit ausgreifende Läufe dominieren diesen Satz, und zum Schluss steigern sich die technischen Anforderungen an den Solisten zu einem Niveau, das dem Hochleistungssport gleicht. Nicht nur die Schnelligkeit der Läufe sondern auch die Intensität, ja Mächtigkeit des Anschlages erfordern Kraft und Kondition. Das Ganze endet in einem geradezu rauschhaften Finale, das man durchaus als Traum eines Sieges des Volkes über die zartistische Regierung begreifen kann. Doch diese von Musikexperten tradierte Interpretation bleibt bis zu einem gewissen Maße Spekulation, da sich Rachmaninow selbst nicht im politischen Sinne über sein Klavierkonzert ausgelassen hat. Man kann diese Musik auch als Spiegelbild der russischen Mentalität sehen, wie Rachmaninow sie selbst empfunden haben mag. Boris Giltburg jedenfalls zeigte sich als wahrer Meister seines Fachs und wirkte trotz seiner Jugend von Anfang an souverän. Sein Vortrag war kein angestrengtes Vorspielen einer technisch höchst anspruchsvollen Partitur sondern eine zupackende, bewusst gestaltete Interpretation. Der Beifall setzte – mit „Bravo“-Rufen durchsetzt – unmittelbar und spontan in außergewöhnlich heftiger Form ein, und aufgrund der Dauer des Applauses fügte Giltburg noch zwei ausgesprochen ausgefallene Zugaben an: ein eher typisches Rachmaninow-Stück und ein eingängiges Tanzlied mit geradezu irrwitziger Rhythmik und Klangfärbung, ebenfalls von .
Nach der Pause folgten noch zwei Stücke, die die Programmatik bereits im Namen tragen. Die beiden Kompositionen stammen von dem italienischen Komponisten Ottorino Respighi und beschreiben die römischen Brunnen – „Fontane die Roma“ – und die römischen Pinien – „Pini di Roma“. Man kann darüber streiten, und der Programmheftbeitrag von Christoph Flamm tut dies in ungewohnt kritischer Form, ob Respighi wirklich die Brunnen und die Pinien im Detail musikalisch nachbilden wollte oder ob er einen allgemeinen Eindruck von Rom in zwei eigenständigen Kompositionen wiedergeben wollte und ihnen erst nachher einen Namen verliehen hat. Eine programmatische Namensgebung trägt ja die Gefahr in sich, dass die Rezipienten nahezu jedem Ton und jeder Klangfärbung eine programmatische Bedeutung gemäß dem Titel beimessen. In einigen Fällen ist dies sicher nicht von der Hand zu weisen, so wenn in den „Pini die Roma“ unüberhörbar Vogelstimmen zwitschern – offensichtlich nicht aus dem Orchester stammend -, während das Plätschern des Wassers in den diversen Brunnen sicher hineininterpretiert werden muss. Das Wichtigste an diesen beiden Stücken ist denn auch nicht die programmatische Aussage im Einzelnen sondern die Klangfärbung, die die Stimmung der einzelnen Tageszeiten – bei den „Fontane di Roma“ steht jeder Brunnen für eine Tageszeit – in geradezu magischer Weise wiedergibt. So erlebt man buchstäblich das Erwachen der Stadt im Morgennebel, erlebt die drückende, einschläfernde Hitze des Mittags und atmet bei den abkühlenden Abendwinden auf. Das alles schafft Respighi allein mit den Klangfarben der einzelnen Instrumentengruppen und mit der Variation des Tempos. Die „Pini di Roma“ enden mit einem gewaltigen Marsch, der an die glorreiche Zeit des alten Roms erinnern soll. Christoph Flamm wirft im Programmheft die Frage auf, ob damit vielleicht auch der Marsch von Mussolino auf Rom gemeint war, lässt sie aber am Ende offen.
Markus Lukas Meister kümmerte sich zu Recht nicht um die politische Ausdeutung dieser beiden Werke sondern zauberte mit den Mitteln des Orchesters die Stimmung eines römischen Sommertages in den Konzertsaal und machte damit Lust auf eine Reise in diese uralte und doch stets neue Metropole Europas.
Nach dem begeisterten Beifall des Publikums griff Martin Lukas Meister überraschend zum Mikrofon und verabschiedete mit launigen Worten und höchstem Bedauern die erste Geigerin und Konzertmeisterin Olga Pogorelova, die an ein anderes Haus geht. Doch er konnte sich nicht verkneifen, ihr neben viel Glück auch noch die Ermahnung mitzugeben, sie werde schon noch merken, was sie an Darmstadt gehabt habe. Die Tränen der Rührung in Olga Pogorelovas Augen konnte man zwar nicht sehen aber erahnen.
Frank Raudszus


No comments yet.