Die Geschichte einer existenziellen Bedrohung
Dieses Buch erschien bereits im Jahr 1938, allerdings in Englisch. Der zweite Weltkrieg dürfte der Hauptgrund dafür gewesen sein, dass es in Deutschland bisher nicht bekannt war. Der Autor war so alt wie sein Jahrhundert und starb 1976, ein weiterer Grund, dass er außerhalb Englands nur wenigen bekannt war. Erst die neue Übersetzung durch Michael Walter hat seinen Roman im deutschen Sprachraum ins Blickfeld gerückt.
Der Roman schildert die Reise des Dampfers „Archimedes“ im Jahre 1929 von der Ostküste der USA nach China. An Bord sind verschiedene Waren für das damals noch unterentwickelte und von niemand ernst genommene China, und chinesische Matrosen sind für die niederen Dienst zuständig. Die Offizieren betrachten sie eher als „Kulis“ denn als gleichwertige Menschen, allerdings ohne dass man sie deswegen als „Untermenschen“ behandelte. Das Schiff wird von einer seriösen und angesehen Rederei betrieben, die auf ihren Ruf achtet und Risikovermeidung als oberstes Prinzip gewählt hat. Die „Archimedes“ selbst ist ausgesprochen stabil und mehr als nur seegängig, also kein „Totenschiff“ à la Traven. Der Kapitän gilt als zuverlässiger und umgänglicher Mensch, die Offiziere sind tüchtig, erfahren und motiviert. Hughes wählt als eine Art „alter ego“ den jungen Offizier Dick Watchett, der zwar nicht die Hauptrolle spielt, aber für die Befindlichkeit eines jungen Mannes in einer existenziellen Notsituation steht.
Die Fahrt bis in die Karibik verläuft routinemäßig und in stillem Einvernehmen zwischen Schiff und Natur. Bereits hier weckt das Buch Assoziationen an Joseph Conrad und seine großen See-Erzählungen. Ähnlich wie dieser Vorgänger schafft auch Highes es, die besondere Atmosphäre auf See wiederzugeben, die durch die Isolation einer Mannschaft vom Rest der Welt auf einem sehr begrenzten Raum und durch die ständige Konfrontation mit der weiten, potentiell gefährlichen See geprägt ist. Watchett, der eben noch im letzten Hafen ein junges Mädchen kennengelernt hat, verliert diese angesichts der besonderen psychischen Anforderungen auch auf einer ruhigen See langsam aber sicher aus den Sinnen und gibt sich ganz dem Einfluss des Seelebens hin.
Über Funk erfährt der Kapitän über eine atlantische Störung. Da die Hurrikanzeit vorbei ist und sich solche Störungen schnell aufzulösen pflegen, sieht er keinen Grund zur Beunruhigung. Dennoch setzt er aus Vorsicht den Kurs so, dass er auch dieser Störung nach menschlichem Ermessen weiträumig aus dem Weg geht.
Doch die Natur richtet sich nicht nach den Berechnungen der Menschen, und hier gleicht Hughes ganz dem Vorbild Joseph Conrad. Während Kapitän und Mannschaft – in der fiktiven Welt des Romans und mit dem begrenzten momentanen Wissen – sich in Sicherheit wiegen, beschleicht den Leser die böse Ahnung einer wachsenden Gefahr, die zunehmend durch die nüchternen Worte von Wetterberichten und die seemännischen Erfahrungsberichte schimmert. Und schließlich kommt es wie befürchtet. Aus der scheinbar harmlosen Störung entwickelt sich nicht nur ein Hurrikan, sondern dieser stellt auch noch alles in den Schatten, was erfahrene Seeleute kennen, und vor allem schlägt er einen unvermuteten Haken und geht direkt über die „Archimedes“ hinweg.
Was nun folgt, ist die Beschreibung einer Situatiion, wie sie keiner der Besatzung je erlebt hat und auch wahrscheinlich nie wieder erleben wird. Das Schiff kann sich anfangs mit geringer Fahrt mühsam gegen die tobende See halten, doch die Luft ist voll von fliegendem Wasser, die Grenze zwischen Wasser und Himmel ist nicht mehr auszumachen, und im Freien reißt der Orkan die Atemluft vom Mund weg. Die Besatzung kann nichts weiter tun als zu hoffen, dass Maschine und Ruder funktionieren und keine schwerwiegende Schäden auftreten. In fast heroischem Fatalismus nehmen sie die Schläge der See hin und warten darauf, dass nach der Vorderseite des Hurrikans dessen windstilles Auge und dann die Rückseite über sie hinwegzieht. Hughes beschreibt diese Situation ohne die bei simpleren Seegeschichten gerne gewählten Stilmittel, die versuchen, das Toben der Elemente durch eine ebenso tobende Sprache nachzuahmen. Gerade die nüchterne, fast fachlich-seemännische Darstellung der Situation auf dem Schiff und die fast gemächliche Ausmalung der seelischen Befindelichkeit einzelner Besatzungsmitglieder verleihen dem Bericht etwas Jenseitig-Existentielles. Hier steht der Mensch in stiller Leidensbereitschaft gegen eine wütende Natur, und Assoziationen an die biblische Sintflut kommen auf.
Dann jedoch läuft das Schiff und damit die Geschichte aus dem Ruder, da sich das Gestänge eben dieses Ruders in verrutschenden Kokosläufern verhakt. Das Schiff treibt quer zur See, und die ungeheure Wucht des Sturms reißt den Schornstein aus seinen Verankerungen. Daraufhin erlöschen die Feuer unter den Kesseln, das Schiff verliert neben der Ruderwirkung auch seinen Antrieb und treibt mit zunehmender Schlagseite quer zur See. Der Orkan hebt die Ladeluken aus ihren Verankerungen, Wasser dringt ein, das die Pumpen ohne Elektrizität nicht herausschaffen können. Auch ein Notruf ist ohne Strom nicht möglich. Das Schiff scheint dem Untergang geweiht und der Zeitpunkt des Kenterns nur noch eine Frage von Stunden zu sein.
Doch in dieser geradezu hoffnungslosen Situation bleiben Kapitän und Besatzung erstaunlich ruhig. Gerade ihr Wissen um die geringe Überlebenswahrscheinlichkeit führt nicht zu Panik sondern zu Gegenmaßnahmen, die den Untergang nur hinauszögern können. Unter unfassbar schwierigen Bedingungen können sie die Luken wieder halbwegs festlaschen und das Schiff zumindest in dem unvermindert tobenden Hurrikan auf dem schmalen Grat zwischen Schwimmfähigkeit und Kentern halten. Die Angst schlägt bei allen außer den Chinesen in einen fatalistischen Widerstand um, der jede noch so kleine Möglichkeit des augenblicklichen Überlebens nutzt. Die chinesichen Matrosen schildert Hughes jedoch als einen über das Deck rutschenden Haufen verängstigter und schreiender Menschen, die für keine Arbeit mehr in Frage kommen. Dies mag aus heutiger Sicht diskriminierend klingen, doch im Jahr 1929 waren sowohl die faktischen Zustände als auch die Einstellung zur politischen Korrektheit anders als heute.
Das herbeigesehnte Auge des Hurrikans stellt sich nicht als windstill heraus sondern als ein Chaos aus Böen aus unterschiedlichsten Richtungen, die das Schiff fast noch mehr schütteln als vorher. Doch nach Aufstellung eines Notschornsteins lässt sich zumindest der Hilfskessel in Betrieb nehmen, sodass die Pumpen wieder ihre Aufgabe übernehmen und die weitere und damit finale Zunahme des Wassers im Schiff verhindern können. Ein erster, wenn auch geringer Fortschritt ist gemacht, und ein schwacher Hoffnungsschimmer dringt durch das düstere Schwarzgrau des Hurrikans.
Bis hierher folgt die Schilderung stilistisch dem Hurrikan. Mit zwar nüchternen Worten aber deshalb nicht weniger eindringlich und mit zunehmender Intensität schildert Hughes die hoffnungslose Drift durch die Vorderfront des Hurrikans. Mit dem Auge ändert er – wie der Hurrikan – die Perspektive. Jetzt rücken die Chinesen in den Mittelpunkt der Erzählung. Sie erzählen sich gegenseitig Schauergeschichten und halten den sturmbedingten Ausfall jeglicher Nahrungsaufnahme für eine Schikane des vermeintlich geldgierigen Kapitäns. Wie im Auge des Hurrikans wird nun auch die Erzählung ruhiger, und Hughes schildert den Lebenslauf eines Chinesen, der als ein chinesischer Simplicissimus verschiedene zivile, miltärische und politische Stationen durchlaufen hat, dabei mehrmals tödliche Gefahren überstanden hat und nun auf diesem Schiff als einfacher Seemann gelandet ist. Tatsächlich hat die Schiffsführung nichts Besseres zu tun, als diesem Mann, der sich nicht besonders hervortut, wegen gefälschter Papiere festzunehmen und einzuschließen. Watchett darf diese „heldenhafte“ Aufgabe übernehmen, sit anfangs auch stolz darauf, doch später plagen ihn Gewissensbisse, da dem festgenommenen Chinesen in seinem Heimatland die Todesstrafe droht. Diese Aktion ist eine kollektive Kompensation der im Grunde genommen unerträglichen, dreitägigen existenziellen Anspannungs und wirkt tatsächlich beruhigend sowohl auf die Schiffsführung als auch auf die anderen Chinesen. Alle sehen, dass wieder normale, sprich administrativ-hierarchische Zustände eingekehrt sind; damit kann die Gefahr nicht mehr so groß sein. Tatsächlich hat sich die Lage ein wenig entspannt, obwohl das Schiff immer noch in der Gefahr des Kenterns schwebt.
Doch der wieder einsatzbereits Funksender holt Hilfe herbei, und bald hängt das Schiff an einem Schleppseil. Seltsam unvermittelt lässt die Spannung des Romans nach. Wer anfangs geglaubt hat, das Martyrium der Besatzung würde sich in der Rückfront wiederholen und in ein dramaturgisch spektakuläres und natürlich katastrophales Finale münden, sieht sich getäuscht. Ohne weitere seemännische und menschliche Höhe- oder Tiefpunkte geht die Geschichte einem undramatischen Ende entgegen. Auch hier bleibt Hughes seiner Perspektive treu: nicht einen effektvollen Roman sondern einen realistischen Bericht über eine letztlich noch glimpflich ausgehende Höllenfahrt zu schreiben.
Das Buch „In Bedrängnis“ ist im Dörlemann-Verlag unter der ISBN 978-3-908777-82-3 erschienen, umfasst 247 Seiten und kostet 19,90 €.
Frank Raudszus

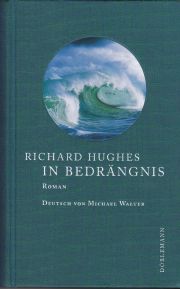
No comments yet.