Im – mittlerweile abgelaufenen – Beethoven-Jahr nimmt es nicht wunder, dass sich auch ausführende Musiker als Buchautoren zu Wort melden. Nach der herausragenden Werk-Analyse von Hans-Joachim Hinrichsen hat der international renommierte Dirigent Christian Thielemann seine ganz persönlichen Eindrücke und Erfahrungen mit Beethovens Musik in dem vorliegenden Buch zu Papier gebracht.
Thielemann, Jahrgang 1959, leitet seit 2012 die Sächsische Staatskapelle Dresden und bekleidet noch andere wichtige Posten im internationalen Musikleben. Stationen davor waren u.a. Assistent von Karajan sowie GMD der Deutschen Oper Berlin und der Münchner Philharmoniker, also durchaus schwergewichtige Positionen.
Thielemann baut sein Buch um Beethovens Sinfonien herum auf. Diese hat er vor Jahren einmal in einem viertägigen „Parforce-Ritt“ paarweise oder im Trio aufgeführt, und diese Aufführungsstruktur erweckt er in seinem Buch mit vielen Details noch einmal zum Leben. Sinfoniekonzerte folgen heute bundes- bis weltweit eigentlich einem einheitlichen Schema: ein modernes Stück, in der Mitte ein großes Solokonzert – Klavier, Geige, etc. – und am Ende eine Sinfonie. Bisweilen verschiebt man die moderne Komposition auch in die Mitte, damit das – konservative – Publikum nicht später kommt oder früher geht. Durchgehend vermeidet man dabei zwei Werke des selben Komponisten, und auch bezüglich der Gewichtung achtet man darauf, dass einem voluminösen Solokonzert eine eher leichte Sinfonie folgt – und umgekehrt. Zwei gewichtige Beethoven-Sinfonien bzw. -Konzerte in einer Aufführung sind verpönt.
Nicht so Thielemann, der gerade in der vergleichenden Aufführung in einem Konzert große Vorteile sieht. Für ihn bestehen enge Beziehungen bestimmter Beethoven-Sinfonien untereinander, die es herauszuarbeiten gilt. So folgen die Erste in C-Dur, die eigentliche die zweite ist, und ihre ältere Schwester in B-Dur noch der Tradition Haydns und Mozarts, wobei die „falsche“ Erste schon wesentlich markantere und eigenwillige Züge aufweist. Die großen Sinfonien beginnen für Thielemann mit der Dritten, der „Eroica“, die Beethoven angeblich Napoleon gewidmet und dann aus Enttäuschung über dessen Kaiserkrönung umgewidmet hat. In einem wahren Mammutprogramm führte Thielemann damals alle drei Sinfonien in einem Konzert auf. Im Buch geht er auf die charakteristischen Merkmale der „Eroica“ und ihre Grenzübertretungen gegenüber der Tradition aus der Sicht des Dirigenten ein.
Die vierte und die fünfte Sinfonie packt Thielemann ebenfalls in ein Programm. Dabei startet er zu einer Ehrenrettung der „geraden“ Sinfonien, die in der öffentlichen Rezeption oft als konventionelle Lückenfüller gesehen werden. Thielemann räumt mit diesem Vorurteil auf und erklärt die Stärken besonders der Vierten, der Sechsten und der Achten, die jede auch eigene Weise Umbrüche und Experimente darstellten, während die ungeraden immer spektakuläre Ergebnisse dieser in den jeweiligen geraden Vorläufern angelegten Versuche waren. Wie auch Hinrichsen verweist er auf die zeitliche Nähe und thematische Komplementarität der fünften und sechsten Sinfonie, obwohl er sie damals nicht gemeinsam aufführte. Dafür passt jedoch die Sechste gut als Gegenstück zur „wilden“ Siebten, in der auch Thielemann einen Höhepunkt der klassischen Sinfonik sieht. Bleiben die Achte, wiederum eine gegen die Konventionen gebürstete, experimentierfreudige Sinfonie, und die sagenumwobene Neunte mit der „Ode an die Freude“. Letzterer widmet sich Thielemann mit vielen aufführungstechnischen Details und mit Beethovens dahinter stehenden Intentionen.
Bei all diesen Betrachtungen behält Thielemann stets die Perspektive des Dirigenten bei und demontiert dabei lustvoll das heroische Bild des großen Dirigenten. Freimütig gesteht er seine eigene Unsicherheit bezüglich Tempi und Dynamik ein und verweist immer wieder auf sein „Bauchgefühl“, das für ihn entscheidender ist als jegliche intellektuelle Analyse. Darüber hinaus betonte er die permanente Unzufriedenheit des Dirigenten mit sich selbst und der letzten Interpretation. Hat die Spannung im langsamen Satz gehalten, waren die Fortissimi nicht energisch genug oder doch zu laut? Es gibt für ihn kein absolute Gewissheit, da Beethovens Angaben dazu entweder vage oder nicht spielbar sind und bisweilen die Interpretation sogar zerstören. In diesem Zusammenhang diskutiert er auch kritisch die „historisch informierte“ Aufführungspraxis, die den angeblichen Willen des Komponisten einschließlich des damals möglichen Klanges wiederherstellen will. Thielemann sieht Beethoven als einen nach vorne blickenden und experimentierfreudigen Musiker, der sicher neue Interpretationsansätze und fortschrittliche Techniken begrüßt hätte, und nicht als jemanden, der die sklavische Einhaltung seiner Interpretationsvorgaben gefordert hätte.
Thielemanns Kritik an seinen anders denkenden Kollegen ist sehr höflich und voller Toleranz, aber letztlich eindeutig: es gibt keine „Soll-Interpretation“ Beethovenscher Musik, jeder Dirigent (und das Orchester) erschafft das musikalische Werk bei jeder Aufführung von Neuem und aus eigener Verantwortung. Das hat nichts mit Missachtung des Komponisten zu tun, sondern erfolgt aus Thielemanns Sicht mit dessen (Beethovens) ausdrücklicher posthumer Ermunterung.
Detailliert geht Thielemann auch auf Beethovens einziger Oper „Fidelio“ ein, auf deren Libretto-Schwächen und die daraus folgenden musikalischen Kompromisse. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass Beethoven die Umsetzung des Wortes in Musik nicht gelegen hat. Als kompromissloser Vertreter der „absoluten“ Instrumental-Musik, die er selbst nicht so genannt hat, konnte er sich nicht dem Wort als zu befolgende Vorgabe unterordnen, was auch an seinem schmalen Liedgut zu erkennen ist.
Dagegen spielen die Solokonzerte eine große Rolle auch für Thielemann. Er kommentiert sie zwar nicht im gleichen Maße wie die Sinfonien aus der tatsächlichen Aufführungspraxis heraus, sondern als Solitäre eigener Art mit ihren jeweils einzigartigen Merkmalen. Das Violinkonzert würdigt er dabei genau so wie die letzten drei Klavierkonzerte.
Bleibt noch die „Missa solemnis“, der Thielemann ein ausführliches Kapitel widmet und die er öfter aufgeführt wissen möchte. Ihre schiere zeitliche und musikalische Größe reduziert jedoch die Möglichkeiten der öffentlichen Aufführung, schließlich muss man ja auch an die Rezeptionskraft des (Abonnements-)Publikums denken. Doch findet dieses monumentale Werk bei Thielemann hohe Wertschätzung bis ins musikalische und intentionale Detail.
Immer wieder betont Thielemann auch die Abhängigkeit des Dirigenten von einem guten Orchester, das die Absichten des Dirigenten nicht nur versteht und nachvollzieht, sondern mitfühlt und eigenständig umsetzt. Dabei erwähnt er die in dieser Hinsicht großartigen Orchester namentlich und mit Beispielen, während er die anderen in höflicher Anonymität belässt. Auch betont er die Zusammenarbeit des Dirigenten auf Augenhöhe mit dem Orchester und erteilt der Selbst-Inszenierung als charismatischer „Maestro“ eine deutliche Absage. Auch hier schimmert die Kritik an der Selbstvermarktung eines Karajan nur verhalten durch. Nachtreten ist nicht Thielemanns Sache.
Als Dirigent hat Thielemann natürlich wenig Berührungspunkte zur Kammermusik – Klaviersonaten und Streichquartette – und erwähnt diese Gattungen auch nur dort, wo sich Parallelen zum sinfonischen Betrieb ergeben, etwa wenn es um Fugentechnik, um Transparenz der Stimmen oder einfach Grenzen sprengende musikalische Experimente Beethovens geht, die man oft besonders deutlich in der Kammermusik findet.
Thielemann bemüht sich in diesem Buch um einen bewusst lockeren, bisweilen sogar saloppen Ton. Damit will er offensichtlich die kulturellen Hemmschwelle im breiten Publikum besonders Beethovens Musik gegenüber überwinden. Das ist insofern lobenswert, als vor allem in Deutschland immer noch die bildungsbürgerliche Tendenz vorherrscht, klassische und speziell Beethovens Musik in den fast jenseitigen Olymp der hehren Hochkultur zu erheben, den man nur mit gebeugtem Knie und gesenkter Stimme erwähnen darf. Dabei war Musik auch in der Klassik in erster Linie Unterhaltung, wenn auch sehr anspruchsvolle. Und dorthin will auch Thielemann zurück, ohne dabei die künstlerischen Ansprüche zu senken. Musik muss einfach Spaß machen, also zurück zum „Bauchgefühl“!
Das Buch ist im Verlag C.H. Beck erschienen, umfasst 271 Seiten und kostet 22 Euro.
Frank Raudszus

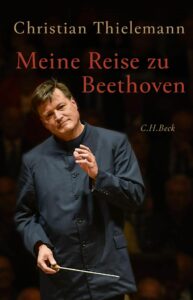
No comments yet.